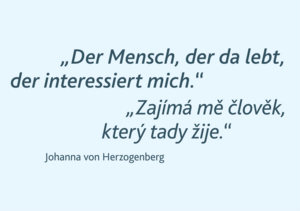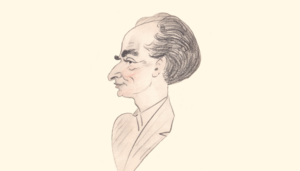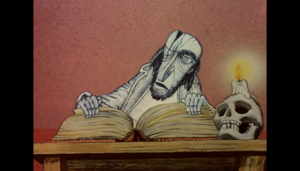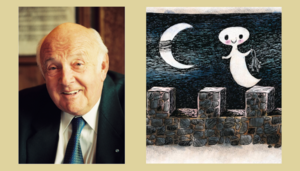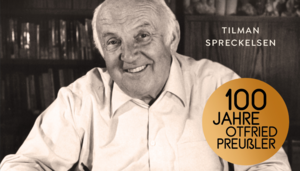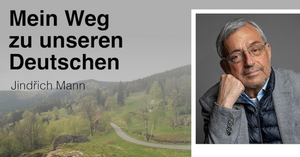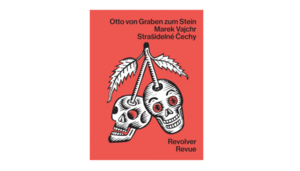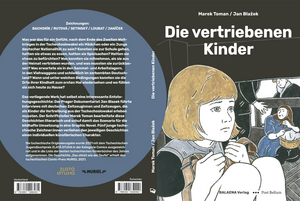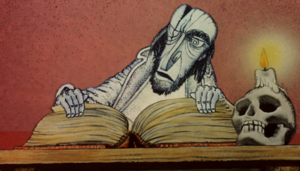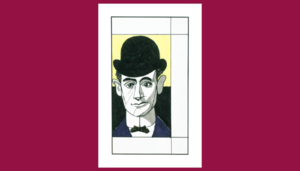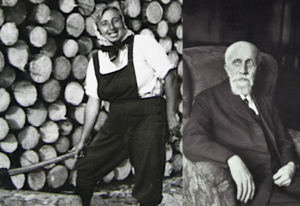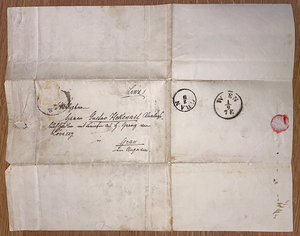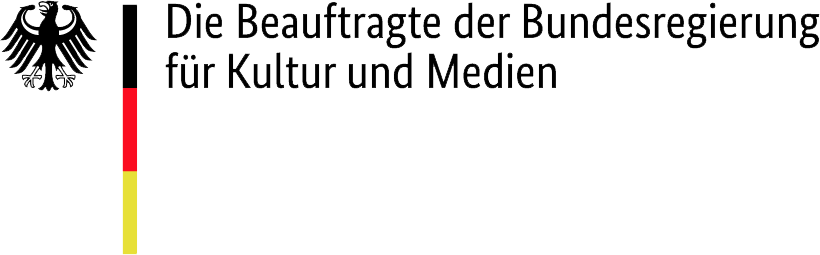Veranstaltungsarchiv2023
Donnerstag, 14. Dezember 2023
18.00 Uhr
Otfried Preußlers Weihnachten
Lesung
Adalbert Stifter Saal, Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
Otfried Preußlers einziger Roman für Erwachsene trägt den Titel Die Flucht nach Ägypten - Königlich böhmischer Teil. 1978 erschienen, ist er eine Weihnachtserzählung par excellence. Er versetzte und versetzt noch heute seine Leser in Begeisterung, weil er auf mehreren Ebenen Weihnachtsgeschichte, Krippenkunst, sprachliche Besonderheiten und Reminiszenzen an die Zeit der Habsburger Monarchie sowie Motive wie Vertreibung, Versöhnung und wundersames Geschehen verbindet.
Daneben gibt es in Preußlers Repertoire weitere bekannte und auch unbekannte Texte, die dem weihnachtlichen Festkreis zuzuzählen sind. Hören Sie, was der große „Geschichtenerzähler“ zu vermelden hat, und lassen Sie sich bei einem Glas Glühwein und etwas Süßem durch eine Ahnung von Weihnachtsfreude verzaubern.
Es lesen Eva Haupt und Raimund Paleczek (beide Sudetendeutsches Museum), Michael Siegle sowie Anna Knechtel (Adalbert Stifter Verein), die Texte aus Preußlers Werk ausgewählt hat.
Bitte melden Sie sich an unter: eveeno.com/preusslers-weihnachten
Dienstag, 12. Dezember 2023
18.00 Uhr
Die vertriebenen Kinder
Buchvorstellung
Ingeborg-Drewitz-Bibliothek, Grunewaldstraße 3, Berlin
Wie fühlte es sich an, nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der Tschechoslowakei ein deutsches Kind zu sein? Um diese Frage kreist ein Comicband, der 2021 in Tschechien und dieses Jahr auch in einer deutschen Ausgabe erschienen ist. Vorgestellt wird er von Textautor Marek Toman, der Zeichnerin Magdalena Rutová und dem Hörfunkjournalisten Andreas Stopp (Deutschlandfunk), der den Abend moderiert.
Als Vorlage für das Buch dienten reale Lebensgeschichten von fünf Deutschen aus der Tschechoslowakei, die als Kinder Vertreibung und Flucht nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten. Als erwachsene Frauen und Männer sprachen sie ihre Erlebnisse und Gedanken in das Mikrofon von Jan Blažek. Als Mitarbeiter der tschechischen Nichtregierungsorganisation Post Bellum sammelt er nicht nur Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, sondern kümmert sich auch darum, diese einem möglichst breiten Publikum zu vermitteln. So regte er auch ihre künstlerische Gestaltung durch tschechische Zeichnerinnen und Zeichner an. Entstanden sind fünf individuell gestaltete Comicgeschichten, die nicht nur von schweren Kindheiten erzählen, sondern auch davon, wie die fünf Interviewten ihr Leben gemeistert haben.
Die deutsche Übersetzung von Raija Hauck erschien im BALAENA Verlag, die tschechische Originalausgabe „Odsunuté děti“ bei Post Bellum. Sie wurde mit dem tschechischen Kinderbuchpreis Zlatá stuha und dem Comicpreis Muriel (für Stanislav Setinský) ausgezeichnet.
Eintritt frei
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Balaena-Verlag, dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Tschechischen Zentrum Berlin. Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.
Donnerstag, 7. Dezember 2023
18.00 Uhr
Der Hohnsteiner Kasper – der Puppenspieler Harald Schwarz
Vernissage
Stiftung Gerhart-Hauptmann Haus, Bismarckstraße 90, Düsseldorf
Den Hohnsteiner Kasper schuf 1928 Max Jacob mit seiner Puppenbühne in Hohnstein in der Sächsischen Schweiz. Von hier aus zogen die charakteristischen Figuren mit den geschnitzten Köpfen in die Welt. Das „Kasperle-Theater“, volkstümliche Unterhaltung, die auch der Information, dem Klatsch und dem Tratsch diente, entwickelte sich bald zu einer anspruchsvollen Theatergattung. 2021 nahm die Deutsche UNESCO-Kommission die Tradition des „Kasper-Theaters“ schließlich als schützenswertes Kulturgut in das Verzeichnis „Immaterielles Kulturerbe“ auf.
Der Puppenspieler Harald Schwarz kam 1921 in Teplitz-Schönau zur Welt. Er war hochmusikalisch, ein erfahrener Komponist und versierter Interpret. Auch war er der letzte Bühnenleiter, der die Hohnsteiner Tradition bis 1995 und damit am längsten fortführte. Jahrzehntelang (von 1939 bis Ende der 1960er Jahre) spielte Schwarz das beliebte traditionelle oder leicht abgewandelte Hohnsteiner Kasperspiel Jacobʼscher Prägung. Ab 1970 ließ er sich für seinen vom Musical beeinflussten Stil in Prag völlig neue Hand- und Stabfiguren herstellen, die sich durch ihre Größe und Fernwirkung auszeichneten. Zu seinen erfolgreichsten Inszenierungen für Erwachsene aus dieser neuen Ära zählt die Puppentheateradaption Der brave Soldat Schwejk (1971). Die Stücke wurden im gesamten Bundesgebiet, in Tschechien, Italien, Südamerika und den USA gezeigt: Schwarz fungierte dabei als Bühnenleiter, Puppenspieler, Texter und Musiker.
Eine Einführung bietet Ausstellungskurator Markus Dorner, Leiter des Museums für PuppentheaterKultur Bad Kreuznach, u. a. mit live gespielten Hohnsteiner Handpuppenszenen.
Öffnungszeiten: Mo und Mi 10-17 Uhr, Di und Do 10-19 Uhr, Fr 10-14 Uhr, Sa auf Anfrage
Laufzeit der Ausstellung: 07. Dezember 2023 bis 24. Februar 2024
Eintritt frei
Eine Veranstaltung der Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus in Kooperation mit dem Museum für PuppentheaterKultur Bad Kreuznach und dem Kulturreferat für die böhmischen Länder.
Donnerstag, 7. Dezember 2023
19.00 Uhr
Jaroslav Rudiš: Weihnachten in Prag
Lesung und Gespräch (auch) über Brücken im deutsch-tschechischen Miteinander
Akademie für Politische Bildung, Buchensee 1, 82327 Tutzing
Jaroslav Rudiš zieht in seiner Erzählung durch die Metropole an der Moldau, begleitet von Jaromír 99, der diese magische und tragikomische Wanderung durch das verschneite Prag illustriert hat.
Das Autoren-Duo erzählt vom Fluss und den vielen alten Brücken, vom Leben im Schatten des Hradschin, der größten Burganlage der Welt. Es schneit, und der Wind ist eisig kalt. Die Straßen sind wie leergefegt. Und doch sind sie voll von alten und neuen Geschichten und Begegnungen. Immer wieder kehrt Rudiš in Wirtshäuser ein, deren Namen klingen wie ein Rundgang durch den Zoo: Zum Schwarzen Ochsen, Zum Nilpferd, Zu den zwei Katzen, Zum Hirschen und Zum Goldenen Tiger. Hier trifft er seine Freunde. Dann geht er weiter und begegnet auch denen, die schon von uns gegangen sind. Darunter Kafka, Hašek und Hrabal. Und dann trifft er auf einen einsamen Mann, der im Lokal Zum ausgeschossenen Auge mit einem Karpfen im großen Gurkenglas auf das Weihnachtswunder wartet. Auf seine Frau und auf das Christkind mit den Geschenken.
Moderation: Andreas Kalina und Anna-Elena Knerich (BR)
Eintritt frei
Anmeldung erforderlich unter: K.Klemm-Vollmer@apb-tutzing.de
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und der Akademie für politische Bildung.
Donnerstag, 7. Dezember 2023
19.00 Uhr
Jaroslav Rudiš: Weihnachten in Prag
Lesung und Gespräch (auch) über Brücken im deutsch-tschechischen Miteinander
Akademie für Politische Bildung, Buchensee 1, 82327 Tutzing
Jaroslav Rudiš zieht in seiner Erzählung durch die Metropole an der Moldau, begleitet von Jaromír 99, der diese magische und tragikomische Wanderung durch das verschneite Prag illustriert hat.
Das Autoren-Duo erzählt vom Fluss und den vielen alten Brücken, vom Leben im Schatten des Hradschin, der größten Burganlage der Welt. Es schneit, und der Wind ist eisig kalt. Die Straßen sind wie leergefegt. Und doch sind sie voll von alten und neuen Geschichten und Begegnungen. Immer wieder kehrt Rudiš in Wirtshäuser ein, deren Namen klingen wie ein Rundgang durch den Zoo: Zum Schwarzen Ochsen, Zum Nilpferd, Zu den zwei Katzen, Zum Hirschen und Zum Goldenen Tiger. Hier trifft er seine Freunde. Dann geht er weiter und begegnet auch denen, die schon von uns gegangen sind. Darunter Kafka, Hašek und Hrabal. Und dann trifft er auf einen einsamen Mann, der im Lokal Zum ausgeschossenen Auge mit einem Karpfen im großen Gurkenglas auf das Weihnachtswunder wartet. Auf seine Frau und auf das Christkind mit den Geschenken.
Moderation: Andreas Kalina und Anna-Elena Knerich (BR)
Eintritt frei
Anmeldung erforderlich unter: K.Klemm-Vollmer@apb-tutzing.de
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und der Akademie für politische Bildung.
Mittwoch, 6. Dezember 2023
19.30 Uhr
Jaroslav Rudiš: Weihnachten in Prag
Lesung und Gespräch
Stadtbücherei Augsburg, Ernst-Reuter-Platz 1, Augsburg
Jaroslav Rudiš zieht in seiner Erzählung durch die Metropole an der Moldau, begleitet von Jaromír 99, der diese magische und tragikomische Wanderung durch das verschneite Prag illustriert hat.
Das Autoren-Duo erzählt vom Fluss und den vielen alten Brücken, vom Leben im Schatten des Hradschin, der größten Burganlage der Welt. Es schneit, und der Wind ist eisig kalt. Die Straßen sind wie leergefegt. Und doch sind sie voll von alten und neuen Geschichten und Begegnungen. Immer wieder kehrt Rudiš in Wirtshäuser ein, deren Namen klingen wie ein Rundgang durch den Zoo: Zum Schwarzen Ochsen, Zum Nilpferd, Zu den zwei Katzen, Zum Hirschen und Zum Goldenen Tiger. Hier trifft er seine Freunde. Dann geht er weiter und begegnet auch denen, die schon von uns gegangen sind. Darunter Kafka, Hašek und Hrabal. Und dann trifft er auf einen einsamen Mann, der im Lokal Zum ausgeschossenen Auge mit einem Karpfen im großen Gurkenglas auf das Weihnachtswunder wartet. Auf seine Frau und auf das Christkind mit den Geschenken.
Moderation: Sonja Hefele
Eintritt: 10 €
Anmeldung erforderlich unter: eveeno.com/Rudis-Augsburg
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und der Deutsch-Tschechischen Gesellschaft Augsburg und Schwaben in Kooperation mit der Stadtbücherei Augsburg.
Donnerstag, 30. November 2023
19.00 Uhr
Dornröschenschlaf
Musik des 18. Jahrhunderts aus dem deutsch-böhmischen Kulturraum
Sudetendeusches Haus, Hochstraße 8, München
Viele Musiker, die im 18. Jahrhundert an den Fürstenhöfen des deutschsprachigen Raumes tätig war, stammten aus Böhmen. Mangels guter Perspektiven in der Heimat suchten die Künstler ihr Fortkommen etwa in Wien oder bei den renommierten Hofkapellen Dresdens, Potsdams, Berlins, Mannheims und Kölns. Dabei agierten sie, wie damals üblich, nicht nur als Instrumentalisten/Interpreten, sondern auch als Komponisten. Nur ein Bruchteil der von ihnen verfassten Werke ist heute bekannt und im Konzertleben präsent; zahlreiche für das Musikleben des 18. Jahrhunderts repräsentative Stücke halten in den Archiven einen Dornröschenschlaf. Das Ensemble Due Oratori widmet diesen böhmischen Komponisten ihr Konzert in historischer Aufführungspraxis.
Das Ensemble Due Oratori besteht aus Antje Becker (Flöte) und Ondřej Bernovský (Cembalo), die sich an der Musikhochschule in Utrecht kennen gelernt haben. Es folgten Konzerte u.a. im Rahmen des Festivals Resonanzen Wien, des Bayerisch-Böhmischen Barockfestivals, der Fringe Concerts des Oude Muziek Festival Utrecht und des BRQ Baroque Music Festival Vantaa (FIN). 2019 veröffentlichte das Ensemble seine erste CD Interlocution, zwei Jahre später die CD Interlocution II mit Werken böhmischer Komponisten, die durch das Kulturreferat für die böhmischen Länder gefördert wurde.
Mit Werken u. a. von Johann Ludwig Dussek (1760–1812), Carl Philipp Emanuel Bach, (1714–1788), Franz Xaver Duschek (1731–1799) und Friedrich Wilhelm Benda (1745–1814).
Eintritt frei, Spenden zugunsten des Netzwerks Gedankendach erbeten
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen
Donnerstag, 30. November 2023
18.00 Uhr
Ein bisschen Magier bin ich schon ... Otfried Preußlers Erzählwelten
Ausstellungseröffnung
Isergebirgs-Museum, Bürgerplatz 1 (Gablonzer Haus), Kaufbeuren-Neugablonz
Otfried Preußler wurde 1923 in Reichenberg/Liberec geboren und zählt zu den bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautoren deutscher Sprache. Er ist weltweit bekannt, seine Bücher wurden in 55 Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Sie sind Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur.
Weniger bekannt ist, dass die meisten seiner Figuren und Erzählstoffe ihren Ursprung in seiner nordböhmischen Heimat und in deren Sagenwelt haben, von welcher der Autor von Jugend an geprägt wurde. Preußlers Bücher sind sozusagen eine Hommage an seine böhmische Heimat.
Die Ausstellung schildert Preußlers Biografie und zeigt anhand ausgewählter Werke, welche Faktoren vor allem in Kindheit und Jugend Einfluss auf sein schriftstellerisches Werk hatten.
Ausstellungsdauer: 1. Dezember 2023 bis 7. April 2024
Öffnungszeiten: Di–So 13–17 Uhr
Eintritt: 5 € (ermäßigt 4 bzw. 2 €)
Eine Veranstaltung des Sudetendeutschen Museums in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein und dem Isergebirgs-Museum Neugablonz
Mittwoch, 29. November 2023
17.00 Uhr
Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945
Ausstellungseröffnung
Moravské zemské muzeum, Palais Dietrichstein - Zelný trh 295, Brünn/Brno, Tschechien
Die Ausstellung beleuchtet das Engagement des Adels aus den böhmischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel von Richard Belcredi, Johanna von Herzogenberg, Ferdinand Kinsky, Nikolaus Lobkowicz, Franz Schwarzenberg, Karl Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg sowie der Familie Thun.
Viele Adelige, die vertrieben wurden oder vor den Kommunisten flohen, hielten den Kontakt mit der alten Heimat aufrecht und pflegten das Bewusstsein der gemeinsamen kulturellen Wurzeln. Damit schlugen sie nach 1945 Brücken über politische, nationale und gesellschaftliche Grenzen hinweg. Ihr Wirken war geprägt von Kultur, Menschlichkeit und christlichem Glauben. Dank ihrer familiären Verbindungen sowie ihrer Zugehörigkeit zu europäischen und christlichen Netzwerken und geleitet von einem ererbten Verantwortungsgefühl, trugen auch sie schließlich zur politischen Wende im Jahr 1989 bei.
Neben den Biografien und Aktivitäten einzelner Persönlichkeiten zeigt die Ausstellung die Hintergründe ihres Engagements, die sich aus der Einstellung des Adels zu Eigentum, Kulturerbe, Nation und dem christlichen Glauben ergeben.
Ausstellungsdauer: bis 7. April 2024
Öffnungszeiten: Mi–Fr 9–17 Uhr, Sa 10-17 Uhr, So 13-17 Uhr
Eintritt in die Ausstellung siehe www.mzm.cz/mista/oteviraci-doba-a-vstupne
In Kooperation mit dem Mährischen Landesmuseum Brünn.
Die Ausstellung des Adalbert Stifter Vereins entstand in Kooperation mit dem Institut zur Erforschung totalitärer Regime (Prag) und Post Bellum (Prag). Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und das Bayerische Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales.
Der Vortrag muss leider ausfallen und wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt!
Donnerstag, 23. November 2023
19.00 Uhr
Publikum der Träume
Wissenschaftlicher Vortrag zur Versinnbildlichung seelischer Vorgänge im Kino
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
Parallelen zwischen Kino und Traum sind in der Forschung häufig gezogen worden. Doch diese Parallelen finden sich schon zu Zeiten, bevor die Bilder laufen lernten: „Mechanisch-optische“ Vorführungen mit Guckkasten und Laterna Magica beflügelten die Fantasie von Literaten und Gelehrten seit Ende des 17. Jahrhunderts. Trotz Kritik und behördlicher Verbote zogen die magischen Kunststücke der charismatischen Gaukler zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an, die oft als „unvernünftige“ Kinder, als „müßige“ und „abergläubische“ Weiber verurteilt wurde. Die Entwicklung der „Kinematografie vor dem Film“ zur echten, vollwertigen Kunstgattung soll in dem Vortrag an einigen mehr oder weniger bekannten, teils völlig vergessenen Texten deutscher und tschechischer Schriftsteller zwischen Barock, Aufklärung und Romantik (Otto von Graben zum Stein, Christoph Martin Wieland, Friedrich Maximilian Klinger, Šebestián Hněvkovský, Karel Hynek Mácha) vorgestellt werden.
Der Otokar-Fischer-Preisträger Marek Vajchr ist Literaturkritiker, Redakteur der Zeitschrift „Revolver Revue“, Schriftsteller und Pädagoge an der Fakultät für Film und Fernsehen der Akademie der musischen Künste (FAMU) in Prag.
Moderation: Franziska Mayer
Eintritt: frei
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins
Dienstag, 21. November 2023
19.00 Uhr
Zwei Schlossbewohnerinnen mit Herz für das Volk
Literatur im Café
Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstr. 90, Düsseldorf
Beide Frauen stammten aus Mähren, heirateten sehr jung und begannen früh zu schreiben. Ebner-Eschenbach machte eine Ausbildung zur Uhrmacherin und verarbeitete das literarisch, während Stonawski, die sich als Schriftstellerin Maria Stona nannte, in einem Roman das Scheitern ihrer Ehe thematisierte. Beide schildern in Erzählungen und Novellen auch das Leben einfacher Menschen auf dem Lande, etwa in Ebner-Eschenbachs Dorf- und Schlossgeschichten und Stonas Dorfgestalten.
Die Veranstaltungsreihe „Literatur im Café“ erinnert an Vertreter der deutschen Literatur aus den böhmischen Ländern, an Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Namen noch bekannt sind, aber auch solche, die weniger bekannt oder in Vergessenheit geraten sind.
Aspekte aus Leben und Werk werden in Kurzvorträgen und Lesungen vermittelt.
Textauswahl und -zusammenstellung: Anna Knechtel
Eintritt frei
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Stiftung Gerhart-Hauptmann-Haus
Montag, 20. November 2023
18.00 Uhr
Böhmerwald von fern und nah III
Lesung und Gespräch mit den Stifter-Stipendiaten
Südböhmische Wissenschaftliche Bibliothek (Jihočeská vědecká knihovna), Lidická 1, Budweis/České Budějovice
Sie stellen im Laufe des Abends ihr bisheriges Schaffen sowie Texte vor, die in Oberplan entstanden sind. Welche Wirkung übten dieser Ort, an dem sich über Jahrhunderte tschechische und deutsche Kultur begegneten, und die zauberhafte Landschaft und Atmosphäre des Böhmerwalds auf ihr Schreiben aus? Hat ihre Begegnung sie selbst und ihr Verständnis von Deutschland und Tschechien irgendwie beeinflusst?
Die Veranstaltung wird gedolmetscht.
Eintritt frei
Mit freundlicher Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei.
Veranstalter: Adalbert Stifter Verein, Adalbert Stifter-Geburtshaus – Regionalmuseum Krumau und Tschechisches Literaturzentrum in der Mährischen Landesbibliothek.
Sonntag, 19. November 2023
18.00 Uhr
Von Prag nach Bad Tölz
Faszinierende Klaviermusik von Hans Winterberg
Kurhaus, Ludwigstr. 25, Bad Tölz
Der 1901 in Prag geborene Komponist und Pianist Hanuš/Hans Winterberg fand seine letzte Ruhestätte 1991 in Bad Tölz. Das faszinierende Œuvre dieses Schülers von Alexander von Zemlinsky, der in den 1930er Jahren zur musikalischen Elite der tschechischen Republik gehörte und aufgrund seiner jüdischen Abstammung ins KZ Theresienstadt deportiert wurde, wird erst seit Kurzem wiederentdeckt. Eine Vorreiterrolle bei dieser Winterberg-Renaissance spielt der international renommierte englische Pianist Jonathan Powell, der 2021 mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. Er stellt im Tölzer Konzert Winterbergs pianistisches Œuvre in den Kontext bedeutender tschechischer Klaviermusik des 19. und 20. Jahrhunderts von Antonín Dvořák bis Josef Suk und Leoš Janáček.
Im ersten Teil des Konzerts findet eine hochkarätig besetzte Diskussionsrunde statt, die sich mit Winterbergs Biografie, Schaffen und der Wiederentdeckung seines Nachlasses vor allem auch vor dem Hintergrund der zeitgeschichtlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt.
Moderation: Bernhard Neuhoff, BR Klassik
Diskussionsteilnehmer:
Peter Kreitmeir (Enkel von Hans Winterberg), Frank Harders-Wuthenow (Verlag Boosey & Hawkes, Berlin), Lubomír Spurný (Masaryk-Universität Brünn), Michael Haas (Exilarte, Wien), Peter Brod (Journalist, London – München – Prag)
Eintritt 19 Euro
Eine Veranstaltung von: Sing- und Musikschule Bad Tölz, Peter Puskas, Bayerischer Rundfunk, Tschechisches Zentrum München, Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein
Donnerstag, 16. November 2023
19.00 Uhr
Tschechien erlesen: Nela Rywiková - Kinder der Wut
Deutsch-tschechische Familiengeschichten
Philologicum, Ludwigstraße 25, München
Auf einem heruntergekommenen Bahngelände finden zwei Jungen eine Leiche, die wie eine Jagdtrophäe präpariert worden ist. Die Ermittlungen der Polizei führen sowohl in hohe politische Kreise und in die Geschäftswelt als auch zu Prostituierten und in zerrüttete Familien. Der Verdacht fällt bald auf Erik, einen alten Sonderling, der mit seinen merkwürdigen Kumpanen in Kneipen herumlungert und sich mit der Präparation von toten Tieren ein Zubrot verdient. Doch der Ermittler Adam Vejnar und seine Chefin Zuzana Turková haben da ihre Zweifel …
Gekonnt verbindet die Autorin einen Mordfall in der Gegenwart mit einer deutsch-jüdischen Familiengeschichte, die viele Jahrzehnte zurückliegt. Dabei zeigt sie, wie leicht ein Mensch Opfer von Wut, Geschichte und einer verdrängten Vergangenheit werden kann.
Der Roman, erschienen 2023 im Mitteldeutschen Verlag, wurde von Christina Frankenberg ins Deutsche übersetzt.
Moderation: Christina Frankenberg
Eintritt frei
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, des Deutschen Kulturforums östliches Europa, des Instituts für slavische Philologie an der LMU München und des Tschechischen Zentrums München.
Mittwoch, 8. November 2023
16.00 und 19.00 Uhr (zwei Veranstaltungen)
Otfried Preußler zum 100. Geburtstag
Literatur im Café
Beide Veranstaltungen im Adalbert Stifter Saal im Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
Schon während seiner Kinderjahre im nordböhmischen Reichenberg/Liberec ließ sich Preußler, angeregt von Vater Josef und Großmutter Dora, von Sagen, Märchen und Abenteuergeschichten verzaubern. Nach den Erfahrungen von Krieg und fünfjähriger Gefangenschaft in sowjetischen Kriegsgefangenenlagern gelangte er nach Deutschland, wo er seine Angehörigen wiederfand und eine Familie gründete. Als Lehrer entdeckte er sein Talent, Kinder anzusprechen und ihre Sorgen und Freuden zu teilen.
In der Veranstaltung werden sein Lebensweg und seine wichtigsten Kinderbücher vorgestellt. Ein Schwerpunkt ist Krabat gewidmet, dieser Geschichte für ältere Kinder und Erwachsene, in der er sich Klarheit über seine eigene Faszination durch „schwarze Magie“ verschaffte. Nicht fehlen wird auch ein Blick auf seinen einzigen Roman für Erwachsene Die Flucht nach Ägypten – Königlich böhmischer Teil, in dem er in altertümlicher Sprache den Lebensraum seiner Kindheit und Jugend vor dem Hintergrund des Fluchtmotivs der Heiligen Familie lebendig werden lässt.
Vor der Nachmittagsveranstaltung können ab 15:45 Uhr Kaffee und Kuchen erworben werden.
Nach der Abendveranstaltung gibt es einen kleinen Getränkeausschank.
Mit Anna Knechtel (Textauswahl und -zusammenstellung) und Florian Kreis, Augsburg
Anmeldung unter: sekretariat@stifterverein.de
Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“.
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Sudetendeutschen Museum
Samstag, 28. Oktober 2023
14.30 Uhr
Mein Weg zu unseren Deutschen
Buchpräsentation
Hotel Post, Herrenstraße 10, Bad Kötzting
„Unsere Deutschen“ werden die Sudetendeutschen von den Tschechen genannt. Lange lebten beide Volksgruppen in Böhmen friedlich zusammen. Nazi-Terror, Vertreibung und kommunistische Ideologie beendeten dieses Zusammenleben gewaltsam. Der Kommunismus dämonisierte fortan alle Sudetendeutschen pauschal als Revanchisten, auf sudetendeutscher Seite blieb man oft auf das eigene Leid fokussiert.
Welche persönlichen Erfahrungen verbinden tschechische Schriftsteller, Künstler und Intellektuelle mit ihren einstigen Landsleuten, aber auch mit den Deutschen generell? Während einer zwischen 2016 und 2018 in München durchgeführten Vortragsreihe erzählten zehn bekannte Autorinnen und Autoren von ihren Erlebnissen und Wahrnehmungen und setzen sich auch mit der Vertreibung der Sudetendeutschen ab 1945 auseinander.
Wolfgang Schwarz, Kulturreferent für die böhmischen Länder, stellt einige Beiträge der Mitwirkenden vor, unter ihnen etwa Radka Denemarková, Tomáš Kafka, Jiří Padevět, Lída Rakušanová, Jaroslav Rudiš, Erik Tabery, Kateřina Tučková und Milan Uhde.
Veranstalter: Ackermann-Gemeinde Bad Kötzting in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder
Samstag, 28. Oktober 2023
15.00 bis 16.30 Uhr
Das kleine Gespenst lädt ein
Kinderführung an Halloween
Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München
Hexen, Zauberer, der Berggeist Rübezahl und natürlich das kleine Gespenst – die Charaktere aus Otfried Preußlers Kinderbüchern wären als Gäste auf einer Halloween-Party gern gesehen! Wir begeben uns auf eine schaurig-schöne Tour durch die Ausstellung, treffen auf spannende Geschichten und gruselige Sagengestalten und finden heraus, ob die geheimnisvolle weiße Frau auch im Museum spukt … Gern dürft ihr verkleidet kommen!
Anmeldung bis 25.10.2023 erbeten unter: anmeldung@sudetendeutsches-museum.de
Abbildung: © Sudetendeutsches Museum/Foto: R. Paleczek
Veranstalter: Sudetendeutsches Museum in Kooperation mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Kulturreferat für die böhmischen Länder
Donnerstag, 26. Oktober 2023
19.00 Uhr
Krabat und Das Märchen von Hans und Marie
Filmvorführung
Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1, München
Čarodějův učeň (R.: Karel Zeman, CZ, 1977, 72 min, OmU) ist eine fesselnde Geschichte um einen faustischen Pakt mit dem Bösen, finstere Wälder, drohenden Tod, jahrelange Sehnsucht nach Erlösung und die Kraft der Liebe. „Die vielseitige Technik des Zeichentrickfilms ermöglicht eine ideale Umsetzung des märchenhaften Stoffes. Vor farbigem Hintergrund bewegen sich die gezeichneten Figuren, zum Teil wird auch Realfilm einbezogen, um Elemente wie Wasser, Rauch, Flammen darzustellen“, schrieb Christel Strobel dazu.
In Pohádka o Honzíkovi a Mařence (R.: Karel Zeman, CZ 1980, 67 min, OmU) wird Hans auf allen seinen Wegen von drei kleinen Kobolden begleitet: Einer ist ein guter Geist, einer ein böser, und der dritte ist ein Schelm. Als Hans sich in eine Elfe verliebt, lässt er sich auf einen Pakt mit dem Bösen ein. Der Film besticht mit schönen Malereien und verträumten Landschaften und erzählt auf ebenso berührende wie faszinierende Weise von zwei Liebenden, die nicht zueinanderfinden.
Eintritt 4 €
Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“.
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und des Filmmuseums München, in Kooperation mit dem Karel-Zeman-Museum in Prag und dem tschechischen Nationalen Filmarchiv.
Samstag, 21. Oktober 2023
15.00 und 18.00 Uhr
Die kleine Hexe – Der Räuber Hotzenplotz
Figurentheater
Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, München
Die Puppenspielkompanie Handmaids Berlin um Sabine Mittelhammer gratuliert Otfried Preußler gleich doppelt zum Geburtstag: mit Die kleine Hexe um 15 Uhr und Der Räuber Hotzenplotz um 18 Uhr.
Die kleine Hexe hat Ärger! Mit ihren noch zu jungen 127 Jahren wird sie von der Muhme Rumpumpel auf dem Blocksberg beim Mittanzen erwischt. Im nächsten Jahr darf sie nur dann bei der Walpurgisnacht dabei sein, wenn sie bis dahin eine gute Hexe geworden ist … Ob sie die schwierige Prüfung bestehen wird?
Der Räuber Hotzenplotz hat sich Großmutters Kaffeemühle eingeheimst! Doch da hat er die Rechnung ohne Kasperl, Seppl und die entschlossene alte Frau gemacht: Die Mühle muss zurück! Gemeinsam begegnen sie dabei dem bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann, einer verzauberten Froschfee und einem Unsichtbarkraut …
Ab vier Jahren. Eintritt: jeweils 5 Euro/Person, Kombiticket für beide Vorführungen 8 Euro
Vorreservierungen unter: sekretariat@stifterverein.de
Aktuell: Vorreservierungen für die Kleine Hexe sind auf Grund großer Nachfrage leider nicht mehr möglich. Es gibt noch einige Restkarten an der Kasse ab 14 Uhr. Für den Räuber Hotzenplotz sind noch Vorreservierungen bis Freitag, 20.10. um 12 Uhr möglich.
Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“
Alle Aufführungsrechte beim Verlag für Kindertheater Uwe Weitendorf
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder. Gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei.
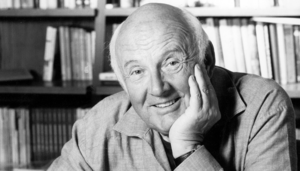
20.–21. Oktober 2023
Fr–Sa 9.00–18.00 Uhr
Otfried Preußler (1923–2013): zu Hause in vielen Welten
Tagung
Krajská vědecká knihovna v Liberci/Wissenschaftliche Regionalbibliothek Reichenberg, Rumjancevova 1362/1, Liberec
Otfried Preußler wurde am 20. Oktober 1923 in Reichenberg geboren. Nach schriftstellerischen Anfängen in seiner Jugend (Erntelager Geyer, 1944) hatte Preußler 1956 seinen ersten großen Bucherfolg mit Der kleine Wassermann, basierend auf Sagen seiner böhmischen Heimatregion (Deutscher Jugendbuchpreis). Im Jahr darauf folgte Die kleine Hexe, 1962 der von bayerischen Motiven inspirierte Räuber Hotzenplotz (zwei weitere Teile kamen 1969 und 1973 heraus). Eine sorbische Sage verarbeitete der Autor in seinem Buch über den Zauberlehrling Krabat, für das er erneut den Deutschen Jugendbuchpreis erhielt. Zahlreiche Adaptionen seiner Bücher in Hörspielen, Puppentheater und Verfilmungen (u.a. 1974 Der Räuber Hotzenplotz, 1977 Čarodějův učeň/Krabat, 2008 Krabat, 2018 Die kleine Hexe, zuletzt 2022 Der Räuber Hotzenplotz) zeugen von seiner Stellung in der Kinder- und Jugendliteratur.
Das detaillierte Programm finden Sie hier.
Die Tagung ist zweisprachig (tschechisch/deutsch) und wird simultan übersetzt. Sie schließt unmittelbar an die Konferenz über Kinder- und Jugendliteratur für tschechische Bibliothekare und Pädagogen an, die mit einem Schwerpunkt auf Otfried Preußler vom 18. bis 19. Oktober am selben Ort stattfindet: https://www.kvkli.cz/akce/id:61264/konference-soucasnost-literatury-pro-deti-a-mladez-2023
Den Flyer für beide Veranstaltungen und das öffentliche Begleitprogramm können Sie hier herunterladen.
Konzeption und Organisation: Dr. Franziska Mayer (mayer@stifterverein.de), Dr. Václav Petrbok (petrbok@ucl.cas.cz) in Zusammenarbeit mit Táňa Kuželková (kuzelkova@kvkli.cz)
Eintritt frei
Ein Zimmerkontingent für angemeldete Besucher ist noch bis 15. August 2023 unter dem Kennwort „Preußler“ reserviert:
Hotel Liberec
Tel.: +420 482 710 028
E-Mail: recepce@hotel-liberec.cz
Web: hotel-liberec.eu
Anmeldung bis 11. Oktober 2023 per Mail an: sekretariat@stifterverein.de
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins München, der Wissenschaftlichen Bibliothek Reichenberg, der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität Prag, des Instituts für tschechische Literatur der tschechischen Akademie der Wissenschaften Prag, in Kooperation mit der Technischen Universität Reichenberg
Donnerstag, 19. Oktober 2023
19.00 Uhr
Karel Zeman: Čarodějův učeň/Krabat
Filmvorführung und Podiumsgespäch
Krajská vědecká knihovna v Liberci/Wissenschaftliche Regionalbibliothek Reichenberg, Rumjancevova 1362/1, Liberec
Am Vorabend der internationalen Tagung über mediale und transkulturelle Kontexte in Leben und Werk des vor 100 Jahren in Reichenberg/Liberec geborenen Kinder- und Jugendbuchautors wird der berühmte Animationsfilm von Karel Zeman aus dem Jahr 1977 nach Otfried Preußlers Roman über einen Zauberlehrling und die Macht schwarzer und weißer Magie gezeigt. Im anschließenden Gespräch berichtet der Übersetzer Radovan Charvát über seine Erfahrungen mit dem Text und seine Begegnungen mit dem Autor.
Der Film wird im Original mit Untertiteln gezeigt, das Gespräch simultan übersetzt.
Eintritt frei
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins München, der Wissenschaftlichen Bibliothek Reichenberg, der Pädagogischen Fakultät der Karls-Universität Prag, des Instituts für tschechische Literatur der tschechischen Akademie der Wissenschaften Prag, in Kooperation mit der Technischen Universität Reichenberg und dem Karel-Zeman-Museum in Prag.
18. Oktober - 30. November 2023
Ein bisschen Magier bin ich schon ... Otfried Preußlers Erzählwelten
Galerie Johann, Palác Liebieg, U Tiskárny 81/1, Liberec
Otfried Preußler wurde 1923 in Reichenberg/Liberec geboren und zählt zu den bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautoren deutscher Sprache. Er ist weltweit bekannt, seine Bücher wurden in 55 Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Sie sind Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur.
Weniger bekannt ist, dass die meisten seiner Figuren und Erzählstoffe ihren Ursprung in seiner nordböhmischen Heimat und in deren Sagenwelt haben, von welcher der Autor von Jugend an geprägt wurde. Preußlers Bücher sind sozusagen eine Hommage an seine böhmische Heimat.
Die Ausstellung schildert Preußlers Biografie und zeigt anhand ausgewählter Werke, welche Faktoren vor allem in Kindheit und Jugend Einfluss auf sein schriftstellerisches Werk hatten.
Öffnungszeiten: Di–So 10–17 Uhr
Eine Veranstaltung des Sudetendeutschen Museums in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein und dem Isergebirgs-Museum Neugablonz
Mittwoch, 18. Oktober 2023
20.00 Uhr
Deutsch-tschechische Familiengeschichten: Jan Štifter – Kathy
Brecht-Haus, Chausseestraße 125, Berlin
In seinem bewegenden literarischen Debut Kathy (2014) greift Jan Štifter das Schicksal seiner Großmutter auf, einer Tschechin, die wegen ihrer Ehe mit einem Deutschen nach 1945 plötzlich selbst als Deutsche gilt. Zwischen der Sorge um ihre vier Kinder, der Angst vor russischen Soldaten und einigen Mitbürgern und der Unsicherheit über das Schicksal ihres Mannes, der in der Wehrmacht dient, versucht Kathy, die Welt um sich zu verstehen – und in ihrer Heimat zu bleiben.
Jan Štifter wurde 1984 in Budweis/České Budějovice geboren, wo er bis heute lebt und als Schriftsteller, Journalist und Organisator von Kulturveranstaltungen arbeitet. Seine Erzählungen und Romane sind der Stadt bzw. der südböhmischen Region verhaftet, inspiriert durch die Geschichte der Orte, Häuser und Menschen, die dort gelebt haben und leben. Sein Roman Sběratel sněhu (Der Schneesammler, 2018) bekam den Preis Česká kniha [Tschechisches Buch]. Zuletzt erschien die Romanchronik Paví hody (Pfauenschmaus, 2022).
Übersetzung ins Deutsche: Emily Wirth
Moderation: Christina Frankenberg (Tschechisches Zentrum)
Eintritt: 6/4 €
Die Veranstaltung wird aufgenommen und später auf YouTube veröffentlicht.
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, des Deutschen Kulturforums östliches Europa und des Tschechischen Zentrums Berlin.
Samstag, 14. Oktober 2023
ab 19 Uhr
Zwölfe hat’s geschlagen ... und andere Geschichten von Otfried Preußler
Die Lange Nacht der Münchner Museen
Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, und Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München
Der weltbekannte Kinderbuchautor Otfried Preußler wurde vor 100 Jahren im nordböhmischen Reichenberg/Liberec geboren. Schon in seiner Kindheit ließ er sich von Sagen, Märchen und Abenteuergeschichten verzaubern.
Katja Amberger, Thomas Birnstiel, Susanne Schroeder und Robert Spitz bringen an diesem Abend einige davon zu Gehör. Sie führen die Besucherinnen und Besucher auf verschlungenen Wegen an unbekannte Orte im Sudetendeutschen Haus sowie im Haus des Deutschen Ostens und lesen unheimliche und unerklärliche Begebenheiten, die Otfried Preußler aufgeschrieben hat.
Die Lesungen werden in 6 Touren im Abstand von 1 Stunde angeboten. Die erste Tour beginnt um 19 Uhr, die letzte, wenn’s zwölfe schlägt, also um 0 Uhr.
Die Tour dauert 50–60 Minuten. Pro Rundgang können bis zu 18 Personen teilnehmen.
Startpunkt: Foyer des Sudetendeutschen Hauses, Hochstr. 8, 81669 München (S-Bahn Rosenheimer Platz), Endpunkt: Gaststätte des HDO, Am Lilienberg 5.
Die Anmeldung erfolgt am Startpunkt ab 18.30 Uhr für die gewünschte Tour, so lange Plätze vorhanden sind. Eine telefonische Reservierung ist nicht möglich.
Eintritt: 20 Euro (Lange-Nacht-Ticket)
Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“.
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Haus des Deutschen Ostens
Samstag, 7. Oktober 2023
19.00 Uhr
Liedfabrik – Písňozávod
Deutsch-tschechisches Kabarett
Kleine Bühne der Pasinger Fabrik, August-Exter-Str. 1 , München
Zitternde Nebelschwaden ziehen durch den schallenden Raum, Jodelgesang vermischt sich mit Balladen, philosophischer Punk und archaischer Einkaufskeltengesang lassen Beine und Herzen zucken. In ihrem wilden zweisprachigen Singspiel suchen Das Thema – To téma mit den Musikern von Jodelix die Wurzeln böhmischer und deutscher Klänge in uns selbst und der Welt um uns – eine musikalische Spurensuche im Heute und in der Vergangenheit.
Das 1. deutsch-tschechische Kabarett Das Thema / To téma wurde 2018 in Prag gegründet. Der Impuls dafür war die deutsch-tschechische Doppelidentität seiner Mitglieder. Das Ensemble spielt mit deutsch-tschechischen Sprach- und Kulturbarrieren mit viel Witz, Selbstironie, aber auch Ernsthaftigkeit. In München präsentierte das Ensemble bereits die Programme „Gefühl und Cit“ und „Das Thema: Erika Mann?“
Das Thema / To téma & Jodelix sind:
Roman Horák – Stimme, Texte, Akkordeon
Philipp Schenker – Stimme, Texte, Ukulele
Marketa Richter – Stimme, Texte, Xylophon
Šimon Janák/Eva Přivozníková – Tuba und andere Blastechnik
Matouš Holada/Jakub Sedláček – Bass und Präzision
Eintritt: 10 Euro (Abendkasse), Vorverkauf hier:
https://www.muenchenticket.de/tickets/performances/e908teyy2nt8/Liedfabrik-Pisnozavod
Nutzung des Kulturpasses: https://storefront.prod.kulturpass.de/product/mp-02955821/details
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit der Pasinger Fabrik und dem Tschechischen Zentrum München
Donnerstag, 5. Oktober 2023
19.00 Uhr
Der Kaiser reist inkognito. Joseph II. und das Europa der Aufklärung
Buchvorstellung und Gespräch
Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München
Die Autorin und Filmemacherin Monika Czernin schildert in ihrem Buch Joseph II. als einen ungewöhnlichen Herrscher im Europa der Aufklärung, der seiner Zeit in vielem voraus war.
Ende des 18. Jahrhunderts geraten die europäischen Monarchien ins Wanken. Der Sohn Maria Theresias, Kaiser Joseph II., erkennt den Reformbedarf und greift begierig die Ideen der Aufklärung auf. Ohne Pomp und großes Gefolge – inkognito – bereist er sein riesiges Reich. Mit eigenen Augen sieht er, wie seine Untertanen leben, unter Frondiensten leiden, hungern. Er trifft einfache Menschen ebenso wie Fürsten und Könige, besucht Krankenhäuser und Fabriken, immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen für den Aufbau seines modernen Staates. Bei seiner Schwester in Versailles sieht er die Französische Revolution heraufziehen. Am Ende hat Joseph II. ein Viertel seiner Regierungszeit unterwegs verbracht.
Monika Czernin, 1965 in Klagenfurt geboren, studierte Pädagogik, Politikwissenschaften, Philosophie und Publizistik in Wien und arbeitete schon während ihres Studiums für den österreichischen Rundfunk (Radio), später für das ORF-Fernsehen, unter anderem im ORF-Büro in Berlin. Anschließend war sie als Kulturredakteurin bei der österreichischen Tageszeitung die „Presse“ tätig. Seit 1996 lebt sie als freie Autorin und Filmemacherin am Starnberger See.
Eintritt frei
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Haus des Deutschen Ostens und dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas
Mittwoch, 4. Oktober 2023
19.30 Uhr
Mensch, Natur und ihre Katastrophen
Historische Fotografien aus Böhmen (Ausstellungseröffnung)
Wallfahrtsmuseum, Marktplatz 10, Neukirchen b. Hl. Blut
Naturkatastrophen steht und stand der Mensch oft machtlos gegenüber. Häufig hat er sie jedoch mit verursacht: Hochwasser ist auch bedingt durch Überregulierung einst freilaufender Flüsse. Erdrutsche sind Folgen extremer Niederschläge, die – ebenso wie Stürme oder Windhosen – durch den Klimawandel zunehmen. Luftverschmutzung schädigt seit vielen Jahrzehnten Wälder und Ackerböden.
Die Ausstellung mit historischen Fotografien aus der Sammlung Scheufler thematisiert Naturkatastrophen in den böhmischen Ländern. Fast alle Aufnahmen stammen aus der Zeit der k. u. k. Monarchie im Zeitraum 1870–1918. Renommierte Fotografen ihrer Zeit wie Rudolf Bruner-Dvořák oder František Krátký fingen die Folgen der Kraft von Wind, Wasser oder Feuer in verschiedenen böhmischen Regionen ein. Die durch Hochwasser 1890 partiell eingestürzte Prager Karlsbrücke ist ebenso zu sehen wie von Erdrutschen beschädigte Häuser im Riesengebirge oder vom Tagebau verursachte Schäden in Brüx/Most. Die Rolle des Menschen wird dabei kritisch gewürdigt, und es wird im Kontext des aktuellen Klimawandels zum Nachdenken angeregt.
Einführung: Wolfgang Schwarz
Ausstellungsdauer: 5.10.2023 bis 28.2.2024
Geöffnet: Di–Fr 9–12 und 13–17 Uhr, Sa−So 9−12 und 13−16 Uhr
Eintritt 4 €/3 € (Eintrittspreis Museum)
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut
Donnerstag, 28. September 2023
19.00 Uhr
Ein Leben in Geschichten
Präsentation der neuen Otfried-Preußler-Biografie
Adalbert-Stifter-Saal, Hochstraße 8, München
Wussten Sie, dass Otfried Preußler eine Geschichte plante, in der die kleine Hexe auf den Räuber Hotzenplotz treffen sollte? Und dass Michael Ende gern bei Familie Preußler zu Besuch war? Immerhin hatten Preußler und Ende ein großes gemeinsames Interesse: Zauberei und Hexenkünste.
Nach intensiven Recherchen gibt Tilman Spreckelsen, Journalist der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, tiefe Einblicke in Leben und Werk des bekannten Kinderbuchautors. Er überrascht mit neuen Erkenntnissen, zeigt Ausschnitte aus dem Privatleben Otfried Preußlers und lässt die Entstehung der bekannten Klassiker lebendig werden. Die erste vollständige Biografie von Otfried Preußler liest sich ebenso informativ wie unterhaltsam.
Eintritt frei
Im Rahmen des Begleitprogramms zur Ausstellung „Ein bisschen Magier bin ich schon … Otfried Preußlers Erzählwelten“.
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder. Gefördert durch die Bayerische Staatskanzlei
Samstag, 23. September 2023
16.00 Uhr
Václav Havel – Europa als Aufgabe. Anregungen und Überlegungen des Dichters, Dramatikers und Staatsmannes Václav Havel zum Thema Europa
Ausstellungseröffnung
Galerie im Europahaus, Kolpingstr. 1, 94078 Freyung
Von seinen ersten Tagen im höchsten politischen Amt an wurden die „Rückkehr nach Europa“, die europäische Integration und die Stellung der Tschechoslowakei bzw. der Tschechischen Republik zu Hauptthemen, denen Präsident Václav Havel Hunderte von Treffen mit Bürgern, Politikern und Journalisten im In- und Ausland widmete. Seine Überlegungen betreffen die historische Bedeutung und die Zukunft der Europäischen Union, ihre Grenzen, die transatlantische Verbindung, das Verhältnis zur Russischen Föderation und die Garantie innerer und äußerer Sicherheit. Vor allem aber betonte er die Werteverankerung der Europäischen Union, den Sinn der Integration und die Identifikation der Europäerinnen und Europäer mit ihr.
Die Ausstellung greift Zitate Václav Havels auf und zeigt ihn in Fotos von Oldřich Škácha, Ondřej Němec und Karel Cudlín. Sie basiert auf dem gleichnamigen Sammelband, der 2016 von der Václav-Havel-Bibliothek herausgegeben wurde, und ist ein gemeinsames Projekt der Václav-Havel-Bibliothek und der Tschechischen Zentren.
Im Rahmen der Vernissage findet ein Zeitzeugengespräch mit dem deutsch-tschechischen Politiker und ehemaligen Berater Havels Milan Horáček (*30.10.1946) statt. Es moderiert Zuzana Jürgens.
Öffnungszeiten der Galerie: Mo & Do 14–18 Uhr; Fr 10–12 & 14–18 Uhr; So 16–17:30 Uhr; Sa 7.10.2023 9–13 Uhr
Eintritt frei
Eine Veranstaltung des Projektes Kulturmanagement Bayern-Böhmen (Europaregion Donau-Moldau e. V.) und von Europe Direct Bayerischer Wald – Böhmerwald – Unterer Inn in Zusammenarbeit mit dem Adalbert Stifter Verein, Bild&Bühne e. V. sowie dem Tschechischen Zentrum München
Montag, 18. September 2023
18.00 Uhr
Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945
Ausstellungseröffnung
Novoměstská radnice – Věž (Neustädter Rathaus – Turm), Karlovo náměstí 1, Praha
Die Ausstellung beleuchtet das Engagement des Adels aus den böhmischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel von Richard Belcredi, Johanna von Herzogenberg, Ferdinand Kinsky, Nikolaus Lobkowicz, Franz Schwarzenberg, Karl Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg sowie der Familie Thun.
Viele Adelige, die vertrieben wurden oder vor den Kommunisten flohen, hielten den Kontakt mit der alten Heimat aufrecht und pflegten das Bewusstsein der gemeinsamen kulturellen Wurzeln. Damit schlugen sie nach 1945 Brücken über politische, nationale und gesellschaftliche Grenzen hinweg. Ihr Wirken war geprägt von Kultur, Menschlichkeit und christlichem Glauben. Dank ihrer familiären Verbindungen sowie ihrer Zugehörigkeit zu europäischen und christlichen Netzwerken und geleitet von einem ererbten Verantwortungsgefühl, trugen auch sie schließlich zur politischen Wende im Jahr 1989 bei.
Neben den Biografien und Aktivitäten einzelner Persönlichkeiten zeigt die Ausstellung die Hintergründe ihres Engagements, die sich aus der Einstellung des Adels zu Eigentum, Kulturerbe, Nation und dem christlichen Glauben ergeben.
Ausstellungsdauer: bis 19. November 2023
Öffnungszeiten: Di–So, 10–18 Uhr (Mittagspause 12–13 Uhr)
Eintritt in die Ausstellung: 60 Kč, ermäßigt 40 Kč, Familienpreis 130 Kč
Anmeldung zur Ausstellungseröffnung hier.
In Kooperation mit dem Neustädter Rathaus, Prag.
Die Ausstellung des Adalbert Stifter Vereins entstand in Kooperation mit dem Institut zur Erforschung totalitärer Regime (Prag) und Post Bellum (Prag). Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und das Bayerische Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

16.–17. September 2023
ab 13.00 Uhr
Böhmerwaldseminar
Kulturhistorische grenzüberschreitende Tagung
Burg Strakonice (Rittersaal), Zámek 1, Strakonice
Das Böhmerwaldseminar versteht sich als grenzüberschreitendes Forum für aktuelle Themen, Projekte und Akteure der deutsch-tschechischen kulturhistorischen Beziehungen. 2023 widmet sich ein Themenblock historischen Naturkatastrophen in den böhmischen Ländern in der Fotografie und
Vorgestellt werden auch aktuelle Projekte an der Karlsuniversität Prag und von Paměť národa zur Aufarbeitung der Geschichte des Eisernen Vorhangs. Ein Rundgang durch das neu rekonstruierte Strakonitzer Museum bietet Eindruck in die Dudelsack-, Motorrad- und Fez-Produktion in der Region.
Südböhmisches Brauchtum mit Dudelsackmusik, Gesang und Tänzen präsentiert das Prácheňský soubor písní a tanců, das älteste noch existierende Folklor-Ensemble in Strakonice. Die Tagung findet unter der Schirmherrschaft und in Zusammenarbeit mit der Stadt Strakonice statt.
Tagungsgebühr: 100 € für deutsche bzw. 1 000 Kč für tschechische Teilnehmer (ohne Übernachtung 300 Kč). Für Studenten bis 26 Jahre gilt ein ermäßigter Beitrag (30 € für deutsche bzw. 300 Kč für tschechische Studenten).
Hier geht’s zum Flyer mit Teilnahmebedingungen.
Anmeldung bis 1. September 2023 erforderlich unter: sekretariat@stifterverein.de
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit der Stadt Strakonice

Donnerstag, 7. September 2023
19.00 Uhr
Emil Viklický: Disturbing the peace
Jazz-Melodram zur Freiheitsphilosophie von Václav Havel
Dům u parku, Palackého 75, Olmütz
Im Rahmen der Tage des Europäischen Erbes und des Festivals Emil Viklický 75
Im Mittelpunkt des Librettos des Jazz-Melodrams Disturbing the peace (Úvahy o svobodě) stehen die Texte und Gedanken Václav Havels zur Freiheit (u. a. aus Moc bezmocných • Audience • O svobodě) sowie das Buch des amerikanischen Historikers Timothy Snyder Über Tyrannei. Zwanzig Lektionen für den Widerstand.
Das Melodram besteht aus drei Teilen. Der erste Teil beschäftigt sich mit Snyders Einlassungen zum Thema Freiheit, der zweite präsentiert — verkürzt auf den Kern des Konflikts — Havels Spiel Audience. Sládek fordert Vaňek dabei auf, ihm als Gegenleistung für eine leichtere Arbeit in der Brauerei eine Verpflichtungserklärung der Staatssicherheit zu unterschreiben. Der dritte Teil enthält einen Auszug aus Havels Rede bei der Überreichung der Freiheitsmedaille in Frankfurt im Jahr 2009.
Emil Viklický (* 23. November 1948 in Olmütz) ist ein tschechischer Komponist und herausragender, international erfolgreicher Pianist des Modern Jazz. Er feiert in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag.
Mitwirkende: Emil Viklický, Jazz Dock Orchestra, Jaromír Meduna, Tomáš Pavelka (künstlerischer Vortrag)
Eine Veranstaltung der Stadt Olmütz in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder
Donnerstag, 17. August 2023
19.00 Uhr
Der kleine gelbe Doppeldecker
Vortrag in der Reihe „Mein Weg zu unseren Deutschen“
Youtube-Premiere
„Unsere Deutschen“ werden die Sudetendeutschen von den Tschechen genannt. Viele Jahrhunderte lang lebten beide Volksgruppen in Böhmen friedlich zusammen. Nationalsozialistischer Terror, Vertreibung und kommunistische Ideologie beendeten dieses Zusammenleben gewaltsam. Der Kommunismus dämonisierte fortan alle Sudetendeutschen pauschal als Revanchisten, auf sudetendeutscher Seite blieb man oft auf das eigene Leid fokussiert. Seit der Samtenen Revolution 1989 hat sich das Verhältnis deutlich entkrampft. Wie blicken tschechische Schriftsteller, Intellektuelle, Journalisten etc. auf „ihre Deutschen“ bzw. die Deutschen im Allgemeinen?
Jindřich Mann, geb. 1948 in Prag, Autor und Filmemacher, ist ein Enkel Heinrich Manns. Seine Mutter Leonie war die einzige Tochter von Heinrich und Maria „Mimi“ Mann; Jindřichs Vater war der in der Tschechoslowakei erfolgreiche Schriftsteller Ludvík Aškenazy. 1968, nach der gewaltsamen Niederschlagung des „Prager Frühlings“, emigrierte Jindřich Mann mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder Ludvík nach Westeuropa. 1989 kehrte er wieder in seine Heimatstadt Prag zurück. 2007 veröffentlichte er den deutschsprachigen Band Prag, poste restante. Eine unbekannte Geschichte der Familie Mann. 2017 erschien der tschechischsprachige Novellen-Band Lední medvěd (Eisbär), im Jahr 2023 sein Roman Stříbrný kouzelník (Der silberne Zauberer).
Moderation: Wolfgang Schwarz
Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum
Freitag, 4. August 2023
18.00 Uhr
Verblichen, aber nicht verschwunden. Eine Spurensuche im Böhmerwald
Vernissage zur Ausstellung
Centrum Hindle, nám. Míru 122, Domažlice
Im Oktober 2019 folgte eine Exkursion mit Studierenden der Universitäten Regensburg, Passau, Prag und Aussig/Ústí nad Labem den Spuren der ehemaligen deutschsprachigen Bevölkerung im Böhmerwald. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wählten jeweils eine der dabei entstandenen Fotografien aus und verfassten dazu einen Text. Die in deutscher und tschechischer Sprache sowie in digitaler Form vorliegende Ausstellung zeigt alte Friedhöfe, Kirchen, Reste verschwundener Orte und neu gegründete Museen und nimmt den Besucher mit in eine vergangene Welt.
Die Vernissage findet am Vorabend des Deutsch-Tschechischen Picknicks der Ackermann-Gemeinde statt.
Ausstellungsdauer: 5. August bis 29. Oktober 2023
Öffnungszeiten: Sonntag und Montag, 13–18 Uhr
Eintritt: 50 Kč
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Verein Chodsko žije! und der Ackermann-Gemeinde
Dienstag, 1. August 2023
19.00 Uhr
Im Fokus: Klaus Holetschek
In der Reihe „Interviews zu Böhmen“
Youtube-Premiere
Die Eltern von Klaus Holetschek, derzeit amtierender bayerischer Gesundheitsminister, stammen aus Marienbad/Mariánské lázně im Egerland und aus Böhmisch Eisenstein/Železná Ruda im Böhmerwald. Während seiner politischen Laufbahn übernahm er Verantwortung auf verschiedenen politischen Ebenen (Bundestagsabgeordneter, Bürgermeister von Bad Wörishofen etc.), derzeit gehört er dem Bayerischen Landtag an. Insbesondere während der COVID-Pandemie und den dadurch bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens war er ein vielgefragter Gesprächsgast der Medien.
Das Gespräch thematisiert die deutschböhmische Herkunft seiner Eltern, den Umgang mit Identitäten und Bräuchen in seiner Familie sowie die mit der COVID-Pandemie verbundenen Herausforderungen für die grenzüberschreitenden bayerisch-tschechischen Beziehungen.
Moderation: Wolfgang Schwarz
Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder
Donnerstag, 27. Juli 2023
19.00 Uhr
Der Kaiser reist inkognito. Joseph II. und das Europa der Aufklärung
- VERSCHOBEN AUF DEN 5.10.2023
Buchvorstellung und Gespräch
Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München
Die Autorin und Filmemacherin Monika Czernin schildert in ihrem Buch Joseph II. als einen ungewöhnlichen Herrscher im Europa der Aufklärung, der seiner Zeit in vielem voraus war.
Ende des 18. Jahrhunderts geraten die europäischen Monarchien ins Wanken. Der Sohn Maria Theresias, Kaiser Joseph II., erkennt den Reformbedarf und greift begierig die Ideen der Aufklärung auf. Ohne Pomp und großes Gefolge – inkognito – bereist er sein riesiges Reich. Mit eigenen Augen sieht er, wie seine Untertanen leben, unter Frondiensten leiden, hungern. Er trifft einfache Menschen ebenso wie Fürsten und Könige, besucht Krankenhäuser und Fabriken, immer auf der Suche nach neuen Erkenntnissen für den Aufbau seines modernen Staates. Bei seiner Schwester in Versailles sieht er die Französische Revolution heraufziehen. Am Ende hat Joseph II. ein Viertel seiner Regierungszeit unterwegs verbracht.
Monika Czernin, 1965 in Klagenfurt geboren, studierte Pädagogik, Politikwissenschaften, Philosophie und Publizistik in Wien und arbeitete schon während ihres Studiums für den österreichischen Rundfunk (Radio), später für das ORF-Fernsehen, unter anderem im ORF-Büro in Berlin. Anschließend war sie als Kulturredakteurin bei der österreichischen Tageszeitung die „Presse“ tätig. Seit 1996 lebt sie als freie Autorin und Filmemacherin am Starnberger See.
Eintritt frei
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Haus des Deutschen Ostens und dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas
Donnerstag, 20. Juli 2023
19.00 Uhr
Ein bisschen Magier bin ich schon ... Otfried Preußlers Erzählwelten
Ausstellungseröffnung
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
Otfried Preußler wurde 1923 in Reichenberg/Liberec geboren und zählt zu den bedeutendsten Kinder- und Jugendbuchautoren deutscher Sprache. Er ist weltweit bekannt, seine Bücher wurden in 55 Sprachen übersetzt und mehrfach verfilmt. Sie sind Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur.
Weniger bekannt ist, dass die meisten seiner Figuren und Erzählstoffe ihren Ursprung in seiner nordböhmischen Heimat und in deren Sagenwelt haben, von welcher der Autor von Jugend an geprägt wurde. Preußlers Bücher sind sozusagen eine Hommage an seine böhmische Heimat.
Die Ausstellung schildert Preußlers Biografie und zeigt anhand ausgewählter Werke, welche Faktoren vor allem in Kindheit und Jugend Einfluss auf sein schriftstellerisches Werk hatten.
Für eine bessere Planung bitten wir um eine Anmeldung unter: anmeldung@sudetendeutsches-museum.de oder Telefon: +49 89 480003-37
Ausstellung bis 12. November 2023
Öffnungszeiten: Di–So 10–18 Uhr
Eine Veranstaltung des Sudetendeutschen Museums in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein und dem Isergebirgs-Museum Neugablonz
Dienstag, 18. Juli 2023
19.00 Uhr
Alma Rosé
Monodrama
Sudetendeutsches Haus, Hochstr. 8, München
Das Stück erzählt die Geschichte der Geigerin Alma Rosé, die auf den Bühnen der größten Konzertsäle Europas ihre Auftritte hatte. Ihre Mutter war die Schwester des Komponisten Gustav Mahler. Wegen ihrer jüdischen Herkunft kam Alma 1943 nach Auschwitz, wo sie Dirigentin des Frauen-Lagerorchesters wurde. Dort starb sie auf mysteriöse Weise im April 1944, wahrscheinlich, nach dem Verzehr vergifteter Lebensmittel.
Alma wird durch Sarah Haváčová verkörpert, die an zahlreichen Prager Theaterbühnen, u. a. im Nationaltheater, Ungelt, Pod Palmovkou oder Kalich spielte. Ihr Monolog wird ergänzt durch die Musik berühmter Komponisten, gespielt vom Womenʹs String Quartet. Es erklingen Werke von Fritz Kreisler, Johann Strauß, Antonín Dvořák, Franz Schubert, Johannes Brahms und Giacomo Puccini.
Mit Hana Dostálová Roušarová (Geige), Gabriela Kubátová (Geige) Dagmar Mašková (Viola) und Vladimíra Sanvito (Violoncello)
Produktion: Jonathan Livingston s.r.o.
Eintritt: 15 €
Eine Veranstaltung des Institutum Bohemicum der Ackermann-Gemeinde in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München und dem Kulturreferat für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein
Freitag, 7. Juli 2023
17.00 Uhr
Sommer auf der Terrasse
Sommerfest mit Lesungen
Sudetendeutsches Haus, Terrasse & Adalbert Stifter Saal, Hochstr. 8, München
75 Jahre alt ist der Adalbert Stifter Verein im vergangenen Jahr geworden. Aber aus guten Gründen wollen wir diesen Geburtstag erst in diesem Jahr gemeinsam mit Freunden und Bekannten offiziell begehen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir der langen Tradition des Vereins und seiner kulturellen Tätigkeit gedenken; aber weniger in Reden und Ansprachen, als beim Austausch von Erinnerungen im persönlichen Gespräch. In kurzen Intermezzi werden Mitglieder und Freunde des Vereins in zwei Leseblöcken einige Kostproben aus ihrem künstlerischen Schaffen vorstellen.
Neben der Gelegenheit zu anregenden Begegnungen bieten wir literarische Kostproben von Johanna Amthor, Harald Grill, Ursula Haas, Sophia Klink, Annelies Schwarz und weiteren Autorinnen und Autoren aus dem Kreis unserer Mitglieder sowie der Stifter-Stipendiaten und beschwingte Musik.
Fürs leibliche Wohl nach böhmischer Art ist ebenfalls gesorgt.
Eintritt frei
Anmeldung bis 30. Juni unter: eveeno.com/ASV-Sommerfest
Freitag, 23. Juni 2023
19.00 Uhr
Gespenstisches Böhmen
Szenische Lesung
Konzertsaal Laurentiuskirche/Kostel sv. Vavřince pod Petřínem, Hellichova 18, Prag
Szenische Lesung aus dem Buch „Strašidelné Čechy“ (Gespenstisches Böhmen; Revolver Revue 2021; Otokar-Fischer-Preis 2022), einer kommentierten Auswahledition der in mehrfach erweiterten mehrbändigen Auflagen erschienenen „Unterredungen von dem Reiche der Geister“ des schillernden preußischen Hofbeamten Otto von Graben zum Stein (1690 bis um 1756). Marek Vajchr übersetzte eine Auswahl aus der Erzählsammlung und kommentiert die Edition gelehrt und doch unterhaltsam, ergänzt mit einem fundierten Vorwort. Otto von Graben zum Stein, heute völlig vergessen, schildert farbenfroh populäre Lesestoffe, in großem Umfang auch aus Prag und Böhmen. Sein Buch begründete im 18. Jahrhundert das Genre der Geister- und Horrorliteratur und wurde vielfach rezipiert.
Mit Michal Kern, Kryštof Krhovják, Kajetán Písařovic und Tomáš Mitura.
Drehbuch und Regie: Ivana Uhlířová und Josefina Karlíková
Bühnenbild: Josefina Karlíková
Musik: Tomáš Hrubiš
Ivana Uhlířová (*1980) Theater- und Filmschauspielerin, Radiosprecherin und Theaterregisseurin. Ensemblemitglied der Städtischen Theater Prag. Ausgezeichnet mit dem Alfréd-Radok-Preis als Talent des Jahres 2006 und mit dem Preis der Jury in Angers als beste Schauspielerin im Kurzfilm Druhé dějství/Zweiter Akt (2008).
Josefina Karlíková (*1995), grafická designérka a divadelnice. Iniciátorka a aktérka divadelního souboru „Strop je nahoře, podlaha je dole“ (E. Ionesco: Plešatá zpěvačka /2015/, V. Sorokin: Dostojevskij-trip /2016/, A. Jarry: Ubu králem /2017/, Projevy z řad pracující inteligence /2020/). Držitelka několika ocenění v oblasti grafického designu (1. místo v kategorii katalogy, 2. místo v kategorii krásná literatura v soutěži Nejkrásnější české knihy 2021 ad.)
Michal Kern (*1979), divadelní a filmový herec. Spolupráce se soubory Městská divadla pražská, Studio Hrdinů, Divadlo Letí, Švandovo divadlo ad. Nositel Ceny České filmové kritiky za herecký výkon ve filmovém snímku Arvéd (2022).
Kryštof Krhovják (*1996), divadelní herec. Aktuální angažmá v Městských divadlech pražských, spolupracuje také se soubory Tygr v tísni a Divadlo D21. Nominace Ceny české divadelní kritiky v kategorii Talent roku (2021).
Tomáš Mitura (*1988), Maler, Illustrator, Grafiker und Musiker.
Kajetán Písařovic (*1982), Theater und Filmschauspieler und Moderator. Arbeit mit den divadelní a filmový herec a moderátor. Spolupráce se soubory Divadlo Neklid, Tygr v tísni, Divadelní spolek JEDL, Chemické divadlo ad.
Eintritt: 150 Kč
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Zeitschrift „Revolver Revue“
Donnerstag, 22. Juni 2023
19.00 Uhr
Prag 1939-1945 unter deutscher Besatzung - FÄLLT LEIDER AUS
Buchvorstellung und Gespräch
Haus des Deutschen Ostens, Am Lilienberg 5, München
Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen 1939 wurde Prag Hauptstadt des Protektorats Böhmen und Mähren. So wurde Prag zum zentralen Ereignisort der nationalsozialistischen Besatzung wie auch des tschechoslowakischen Widerstandes (Heydrich-Attentat), viele historische Spuren sind bis heute sichtbar. Der Autor Jiří Padevět bietet erstmals ein umfangreiches, detailliertes und reich bebildertes Nachschlagewerk zur Moldaustadt während der deutschen Besatzung, also im Zeitraum von März 1939 bis Mai 1945. Das Buch ist topografisch gegliedert, der Aufbau richtet sich nach den heutigen Stadtteilen oder Verwaltungsbezirken Prags sowie dessen Randgebieten. Damit eignet es sich auch als Reiseführer für Geschichtsinteressierte.
Jiří Padevět, geboren 1966 in Prag, ist Autor und Verlagsdirektor (Academia) und konzentriert sich in seinen Büchern auf die Zeit der deutschen Besatzung sowie die unmittelbar nachfolgende Periode. Für sein nun auf Deutsch vorliegendes Buch „Prag 1939–1945 unter deutscher Besatzung“ (übersetzt von Kathrin Janka und erschienen im Mitteldeutschen Verlag 2020) erhielt er 2014 den tschechischen Literaturpreis Magnesia Litera (Buch des Jahres in der Kategorie Sachbuch).
Eintritt frei
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Haus des Deutschen Ostens
15.–18. Juni 2023
„Unsere Deutschen“
Exkursion nach Aussig und Umgebung
Die Exkursion führt an wichtige Orte der gemeinsamen deutsch-tschechischen Geschichte. In Aussig/Ústí nad Labem wurde dazu 2021 die Ausstellung „Unsere Deutschen“ durch das Collegium Bohemicum fertig gestellt, in der die zentralen Aspekte des jahrhundertelangen deutsch-tschechischen Zusammenlebens in den böhmischen Ländern im Mittelpunkt stehen. Neben einer ausführlichen Führung durch die Ausstellung wird das Zisterzienserkloster Kloster Ossegg/Osek besucht, das im 19. Jahrhundert zu einem wichtigen Zentrum für Literatur und Wissenschaft Nordböhmens wurde.
Besichtigt wird auch das Schloss Eisenberg/Jezeří, das Ende des 18. Jahrhunderts seine kulturelle Blüte erlebte. Zu den prominenten Persönlichkeiten, die das Schloss besuchten, gehören Johann Wolfgang von Goethe, Ludwig van Beethoven, dessen „Eroica“ auf dem Schloss aufgeführt wurde, oder Christoph Willibald Gluck, dessen Vater hier als Forstmeister beim Fürsten angestellt war. Ein Unikum ist die 1975 um 841 Meter verschoben Maria-Himmelfahrtskirche in Brüx/Most, die ebenfalls besucht wird.
Ergänzt wird das Programm durch Gespräche mit Vertretern des Centrum Bavaria Bohemia in Schönsee und des Kulturzentrums Řehlovice, zwei Institutionen, die sich dem deutsch-tschechischen Kulturaustausch intensiv widmen. Das genaue Programm und organisatorische Hinweise werden noch bekanntgegeben. Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 begrenzt. Die Reise startet und endet in München und findet in Kooperation mit Krizek-Reisen Prag statt.
Hier geht´s zum Programm und zu Anmeldeinformationen.
Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit der Ackermann-Gemeinde
Donnerstag, 15. Juni 2023
19.00 Uhr
Unter dem Steinernen Meer
Lesung und Gespräch
Café/Kavárna Lanna, Jiráskovo nábřeží 45, Budweis/České Budějovice
In seinem neuesten Roman schildert der Literaturhistoriker und Schriftsteller Peter Becher die unauflösbare Verstrickung von Freundschaft und Verrat, Triumph und Niederlage, Gewalt und Schwäche, welche die böhmische Geschichte des 20. Jahrhunderts so verhängnisvoll prägte.
Der Schauplatz: die Südböhmische Metropole Budweis. Die Akteure: der Arzt Karl Tomaschek und der Ingenieur Jan Hadrava, die trotz unterschiedlichem nationalen Hintergrund in der Zwischenkriegszeit befreundet waren. Der eine wurde vertrieben, der andere nach dem Prager Frühling mit Berufsverbot belegt. Ihre zufällige Begegnung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in Stifters Geburtsort Oberplan/Horní Planá weckt Erinnerungen und Emotionen.
Die Moderation des Gesprächs übernimmt Jan Štifter (Schrifstteller und Journalist), Lesung auf Tschechisch: Jiří Šesták (Schauspieler, Schriftsteller und Politiker).
Eintritt frei
In Kooperation mit dem Kulturmanagement Bayern-Böhmen, Europaregion Donau-Moldau
Freitag, 9. Juni 2023
19.00 Uhr
Die vertriebenen Kinder
Buchvorstellung im Rahmen des Comicfestivals München
Projektor, HP8 Gasteig, Hans-Preißinger-Str. 8, München
Wie erlebten Kinder das Ende des Zweiten Weltkriegs? Was konnten sie mitnehmen, und wie war der Abschied von ihrem Heimatort? Wie war ihre Ankunft im zerstörten Deutschland? Und wo fühlen sie sich heute zu Hause? Auf diese Fragen antworteten Zeitzeugen, die die Vertreibung aus der Tschechoslowakei nach 1945 als Kinder erlebt haben.
Aus zahlreichen Filmgesprächen hat der Dokumentarfilmer Jan Blažek (Post Bellum, Prag) fünf Lebensgeschichten ausgewählt und zusammen mit dem Schriftsteller Marek Toman und fünf tschechischen Comiczeichnern und -zeichnerinnen – Jakub Bachorík, Magdalena Rutová, Stanislav Setinský, Františka Loubat und Jindřich Janíček in die Graphic Novel Odsunuté děti (Vertriebene Kinder, 2020) verwandelt. Die deutsche Übersetzung kam 2023 im Verlag Balaena in der Übersetzung von Raija Hauck heraus.
Der Schriftsteller Marek Toman und die Zeichnerin Magdalena Rutová (angefragt) reden über die Entstehung der Graphic Novel und über Flucht und Vertreibung aus der Perspektive der Kinder. Moderation: Anna-Elena Knerich (BR).
Eintritt frei
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Balaena-Verlag und der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.
Samstag, 27. Mai 2023
16.30 Uhr
Otfried Preußler zum 100. Geburtstag
Literatur im Café
Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg
Der weltbekannte Kinderbuchautor Otfried Preußler wurde vor 100 Jahren geboren. Ein Anlass, ihn für sein immer noch aktuelles Werk zu ehren und einen Blick nicht nur auf seine Bücher, sondern auch auf seine Biografie zu werfen.
Schon während seiner Kinderjahre im nordböhmischen Reichenberg/Liberec ließ sich Preußler, angeregt von Vater Josef und Großmutter Dora, von Sagen, Märchen und Abenteuergeschichten verzaubern. Nach den Erfahrungen von Krieg und fünfjähriger Gefangenschaft im sowjetischen Zwangsarbeitslager Jelabuga gelangte er nach Deutschland, wo er seine Angehörigen wiederfand und eine eigene Familie gründete. Er wurde Lehrer und entdeckte beim Erzählen und Schreiben sein Talent, Kinder anzusprechen und ihre Sorgen und Freuden zu teilen.
In der Veranstaltung werden sein Lebensweg und seine wichtigsten Kinderbücher vorgestellt. Ein Schwerpunkt wird „Krabat“ gewidmet, dieser Geschichte für ältere Kinder und Erwachsene, mit der er sich über seine eigene Faszination durch „schwarze Magie“ Klarheit verschaffte. Nicht fehlen wird sein einziger Roman für Erwachsene „Die Flucht nach Ägypten – Königlich böhmischer Teil“, in dem er in altertümlicher Sprache den Lebensraum seiner Kindheit und Jugend vor dem Hintergrund des Fluchtmotivs der Heiligen Familie lebendig werden lässt.
Textzusammenstellung und Lesung: Anna Knechtel
Im Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Regensburg
Samstag, 27. Mai 2023
14.30 Uhr
Entschieden für Verständigung
Junge Tschechen und die eigene Geschichte
Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg
Die deutsch-tschechischen Beziehungen erleben eine Zeit der Normalität; vor 1989 tabuisierte Themen wurden in den letzten Jahrzenten dank Literatur, Film und vielen bürgerlichen Initiativen vielfältig diskutiert. Was bedeutet diese Entwicklung für die weitere Arbeit der auf diesem Feld engagierten Akteure, wie blicken sie in die Zukunft, und wie arbeiten sie mit der jüngeren Generation?
Eine Podiumsdiskussion mit Veronika Kupková (Antikomplex) und Petr Kalousek (Meeting Brno).
Moderation: Blanka Návratová (Tschechisches Zentrum München)
Im Rahmen des Sudetendeutschen Tages in Regensburg
Eine Veranstaltung der Ackermann-Gemeinde und des Kulturreferats für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München und dem Sudetendeutschen Priesterwerk
Samstag, 27. Mai 2023
14.30 Uhr
Die vertriebenen Kinder
Donau-Arena, Walhalla-Allee 24, Regensburg
Wie erlebten Kinder das Ende des Zweiten Weltkriegs? Was konnten sie mitnehmen, und wie war der Abschied von ihrem Heimatort? Wie war ihre Ankunft im zerstörten Deutschland? Und wo fühlen sie sich heute zu Hause? Auf diese Fragen antworteten Zeitzeugen, die die Vertreibung aus der Tschechoslowakei nach 1945 als Kinder erlebt haben.
Aus zahlreichen Filmgesprächen hat der Dokumentarfilmer Jan Blažek (Post Bellum, Prag) fünf Lebensgeschichten ausgewählt und zusammen mit dem Schriftsteller Marek Toman und fünf tschechischen Comiczeichnern und -zeichnerinnen – Jakub Bachorík, Magdalena Rutová, Stanislav Setinský, Františka Loubat und Jindřich Janíček in die Graphic Novel Odsunuté děti (Vertriebene Kinder, 2020) verwandelt. Die deutsche Übersetzung kam 2023 im Verlag Balaena in der Übersetzung von Raija Hauck heraus.
Jan Blažek stellt das Buch und das Oral-History-Projekt vor und spricht im Anschluss mit einigen der Zeitzeugen, deren Geschichten dem Band zugrunde liegen.
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Balaena-Verlag und der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.
Mittwoch, 24. Mai 2023
19.00 Uhr
Otfried Preußler zum 100. Geburtstag
Literatur im Café
Stadtbücherei, Ernst-Reuter-Platz 1, Augsburg
Der weltbekannte Kinderbuchautor Otfried Preußler wurde vor 100 Jahren geboren. Ein Anlass, ihn für sein immer noch aktuelles Werk zu ehren und einen Blick nicht nur auf seine Bücher, sondern auch auf seine Biografie zu werfen.
Schon während seiner Kinderjahre im nordböhmischen Reichenberg/Liberec ließ sich Preußler, angeregt von Vater Josef und Großmutter Dora, von Sagen, Märchen und Abenteuergeschichten verzaubern. Nach den Erfahrungen von Krieg und fünfjähriger Gefangenschaft im sowjetischen Zwangsarbeitslager Jelabuga gelangte er nach Deutschland, wo er seine Angehörigen wiederfand und eine eigene Familie gründete. Er wurde Lehrer und entdeckte beim Erzählen und Schreiben sein Talent, Kinder anzusprechen und ihre Sorgen und Freuden zu teilen.
In der Veranstaltung werden sein Lebensweg und seine wichtigsten Kinderbücher vorgestellt. Ein Schwerpunkt wird „Krabat“ gewidmet, dieser Geschichte für ältere Kinder und Erwachsene, mit der er sich über seine eigene Faszination durch „schwarze Magie“ Klarheit verschaffte. Nicht fehlen wird sein einziger Roman für Erwachsene „Die Flucht nach Ägypten – Königlich böhmischer Teil“, in dem er in altertümlicher Sprache den Lebensraum seiner Kindheit und Jugend vor dem Hintergrund des Fluchtmotivs der Heiligen Familie lebendig werden lässt.
Textzusammenstellung und Lesung: Anna Knechtel
Moderation: Sonja Hefele
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins in Kooperation mit der Deutsch-Tschechischen Gesellschaft Augsburg und Schwaben
Donnerstag, 18. Mai 2023
18.00 Uhr
Karel Zeman: Čarodějův učeň
Filmvorführung und Diskussion
Kino Ponrepo, Bartolomějská 291/11, Prag
Karel Zemans Trickfilm über den Zauberlehrling Krabat ist an Otfried Preußlers gleichnamigen Roman von 1971 angelehnt. Der Film entstand 1977, noch vor der tschechischen Übersetzung. Wie es dennoch bereits so früh zu der Verfilmung kommen konnte, darüber spricht die Tochter des Regisseurs, Ludmila Zemanová, die selbst an dem Filmprojekt beteiligt war.
Das Werk erzählt in unverwechselbarem Stil die Geschichte des Jungen Krabat, der von einem sprechenden Raben in eine dunkle Mühle eingeladen wird. Der arme und hungrige Junge beschließt, hier sein Glück zu versuchen und das Müllerhandwerk zu erlernen. Doch nichts ist, wie es zunächst scheint. Der geheimnisvolle Rabe ist in Wirklichkeit ein grausamer Zauberer, der Krabat und die anderen Müllerburschen in die Geheimnisse der schwarzen Magie einweiht. Nach und nach werden die Lehrlinge immer besser darin, sich in verschiedene Tiere zu verwandeln und dunkle Rituale durchzuführen. Bei einem dieser Rituale lernt der Held ein schönes Mädchen kennen, in das er sich verliebt. Damit beginnt sein Weg aus dem Bann des Zauberers.
Im Gespräch mit dem Historiker und Leiter des Collegium Bohemicum in Aussig/Ústí nad Labem, Petr Koura, gibt Ludmila Zemanová Auskunft nicht nur über die Zusammenarbeit mit Otfried Preußler, sondern auch über die Arbeit am Film selbst. Die tschechische Übersetzung von Preußlers Krabat erschien erst 1996, übersetzt von Radovan Charvát, die zweite Auflage von 2013 wurde von Ludmila Zemanová illustriert.
In Kooperation mit dem Goethe-Institut Prag und dem Collegium Bohemicum.
Mittwoch, 17. Mai 2023
17.00 Uhr
Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945
Ausstellungseröffnung
Stadtmuseum/Muzeum města Ústí nad Labem, Masarykova 1000, Aussig/Ústí nad Labem
Die Ausstellung beleuchtet das Engagement des Adels aus den böhmischen Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg am Beispiel von Richard Belcredi, Johanna von Herzogenberg, Ferdinand Kinsky, Nikolaus Lobkowicz, Franz Schwarzenberg, Karl Schwarzenberg, Pater Angelus Waldstein-Wartenberg OSB, Daisy Waldstein-Wartenberg sowie der Familie Thun.
Viele Adelige, die vertrieben wurden oder vor den Kommunisten flohen, hielten den Kontakt mit der alten Heimat aufrecht und pflegten das Bewusstsein der gemeinsamen kulturellen Wurzeln. Damit schlugen sie nach 1945 Brücken über politische, nationale und gesellschaftliche Grenzen hinweg. Ihr Wirken war geprägt von Kultur, Menschlichkeit und christlichem Glauben. Dank ihrer familiären Verbindungen sowie ihrer Zugehörigkeit zu europäischen und christlichen Netzwerken und geleitet von einem ererbten Verantwortungsgefühl, trugen auch sie schließlich zur politischen Wende im Jahr 1989 bei.
Neben den Biografien und Aktivitäten einzelner Persönlichkeiten zeigt die Ausstellung auch die Hintergründe ihres Engagements, die sich aus der Einstellung des Adels zu Eigentum, Kulturerbe, Nation und dem christlichen Glauben ergeben.
Im Anschluss Filmvorführung „Adel im Exil“ (D/CZ 2022, Drehbuch: Jan Blažek (Post Bellum), OmU 30 Minuten).
Informationen zum Begleitprogramm und Führungen unter www.muzeumusti.cz/vystavy
Ausstellungsdauer bis 27. August 2023
Öffnungszeiten: Di–So, 9–18 Uhr
Eintritt frei
In Kooperation mit dem Museum der Stadt Aussig/Ústí nad Labem
Die Ausstellung entstand in Kooperation mit dem Institut zur Erforschung totalitärer Regime (Prag) und Post Bellum (Prag) und wurde durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und das Bayerische Ministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
Montag, 15. Mai 2023
20.00 Uhr
Tschechien erlesen.
Lesungen und Gespräch mit zwei Autorinen
Brecht-Haus, Chausseestraße 125, Berlin
In den letzten Jahren war das Zusammenleben von Deutschen und Tschechen im 20. Jahrhundert in Tschechien wiederholt ein großes Thema, in Kunst, Film und Literatur. Die Aufarbeitung der tabuisierten Wendepunkte des 20. Jahrhunderts, durch die dieses Zusammenleben in die Brüche ging, sind weit fortgeschritten. Nun konzentrieren sich Autorinnen und Autoren auf das Private und gehen auch in der eigenen Familiengeschichte auf Spurensuche. So etwa Alice Horáčková in ihrem Roman „Rozpůlený dům“ (Ein geteiltes Haus, 2022) und Veronika Jonášová in „Ada“ (2022). Beide Bücher stellen das Konzept einer einfachen – nationalen – Identität und die traditionelle Auslegung der Geschichte in Frage. Was hat die beiden Schriftstellerinnen motiviert, solch persönliche Texte zu schreiben? Wie verlief die Spurensuche in der eigenen Familie? Und was haben sie über sich selbst, aber auch über das Land, in dem sie leben, erfahren?
Alice Horáčková (geboren 1980) ist Journalistin und Schriftstellerin. Sie veröffentlichte eine Biografie über die Beatnik-Dichterin Vladimíra Čerepková (2014) und sprach in 7x ve vedlejší úloze (7x in der Nebenrolle, 2016) mit Geschwistern bekannter Persönlichkeiten wie Ivan M. Havel, Helena Landovská oder Jana Navrátilová. „Rozpůlený dům“ (Ein geteiltes Haus, 2022) ist ihr zweites belletristisches Buch, ein vielstimmiger Familienroman, in den sie Familiengeschichten, Erinnerungen und Archivdokumente einfließen lässt. Ein Roman, der die Lebenswelt eines Dorfes im Riesengebirge vor und in dem Zweiten Weltkrieg schildert und die Unzulänglichkeit nationaler Zuweisungen angesichts der Anforderungen, die das Leben an die Menschen stellt, eindeutig vor die Augen führt.
Veronika Jonášová (geboren 1982) ist Journalistin und schreibt aktuell für die tschechische Ausgabe der Zeitschrift „Forbes“. Sie arbeitete als Reporterin und Moderatorin im Tschechischen Fernsehen, von 2019 bis 2022 lebte sie in Berlin. „Ada“ (2022) ist ihr belletristisches Debüt, in dessen Mittelpunkt eine junge Fernsehjournalistin steht, die eher zufällig auf die deutschen Wurzeln ihrer Familie stößt. Nach und nach wird die Nachkriegsgewalt an der deutschen Bevölkerung unweit Olmütz/Olomouc aufgedeckt; der Urgroßvater wurde im Internierungslager Hodolein/Nové Hodolany, der sogenannten Hodoleiner Hölle, umgebracht. Auch hier fließen Zeugenberichte und Erinnerungen ein und ergänzen die unbekannte Geschichte einer geteilten Familie.
Eintritt: 6/4€
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, des Deutschen Kulturforums östliches Europa und des Tschechischen Zentrums Berlin.
Freitag, 12. Mai 2023
10.00 Uhr & 19.00 Uhr
Die vertriebenen Kinder
Buchvorstellung und Workshop
Stadtbücherei Augsburg, Ernst-Reuter-Platz 1, Augsburg
Wie erlebten Kinder das Ende des Zweiten Weltkriegs? Was konnten sie mitnehmen, und wie war der Abschied von ihrem Heimatort? Wie war ihre Ankunft im zerstörten Deutschland? Und wo fühlen sie sich heute zu Hause? Auf diese Fragen antworteten Zeitzeugen, die die Vertreibung aus der Tschechoslowakei nach 1945 als Kinder erlebt haben.
Aus zahlreichen Filmgesprächen hat der Dokumentarfilmer Jan Blažek (Post Bellum, Prag) fünf Lebensgeschichten ausgewählt und zusammen mit dem Schriftsteller Marek Toman und fünf tschechischen Comiczeichnern und -zeichnerinnen – Jakub Bachorík, Magdalena Rutová, Stanislav Setinský, Františka Loubat und Jindřich Janíček in die Graphic Novel Odsunuté děti (Vertriebene Kinder, 2020) verwandelt. Die deutsche Übersetzung kam 2023 im Verlag Balaena in der Übersetzung von Raija Hauck heraus.
Zu Gast in Augsburg sind Jan Blažek und die Zeichnerin Magdalena Rutová, die um 15.00 Uhr auch einen Comic-Workshop für Kinder anbietet.
Eintritt frei
Im Rahmen des Festivals DIALOG 2023
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Balaena-Verlag, der Deutsch-Tschechischen Gesellschaft Augsburg und Schwaben und der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Gefördert durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds.
Donnerstag, 11. Mai 2023
18.30 Uhr
War Kafka ein Sudetendeutscher?
Podiumsdiskussion mit Musik
Botschaft der Tschechischen Republik, Wilhelmstr. 44, Berlin
Wer waren eigentlich die Deutschen in den böhmischen Ländern, und wie versteht sich die deutsche Minderheit in der Tschechoslowakei heute? Was unterscheidet die Sudetendeutschen von Deutschböhmen, und warum werden die Prager deutschen Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowohl in den Kanon der österreichischen als auch in den der deutschen Literatur aufgenommen? Diese und weitere Fragen nach der kulturellen, historischen und sprachlichen Identität werden aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet, so dass deutlich wird, wie multikulturell das (Selbst)-Verständnis der Deutschen der Region ausgeprägt ist.
Es diskutieren Peter Becher (Vorstandsvorsitzender des Adalbert Stifter Vereins und Schriftsteller, Holzkirchen), Peter Brod (Journalist, Prag), Johannes Jetschgo (Autor und Journalist, Linz) und Zuzana Schreiberová (Multikulturelles Zentrum Prag). Moderation: Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein).
Die Pianistin Maja Matijanec umrahmt das Podiumsgespräch mit Stücken von Bedřich Smetana und Erwin Schulhoff.
Eintritt frei
Anmeldung erforderlich unter: veranstaltungen_berlin@embassy.mzv.cz
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Tschechischen Botschaft in Berlin und dem Deutschen Kulturforum östliches Europa.
Donnerstag, 11. Mai 2023
19.00 Uhr
Mütterchen Prag hat Krallen
Buchpräsentation, Lesung und Musik
Weinschenkvilla, Hoppestraße 6, Regensburg
Günter Grass schickte ihn 1970 nach Prag zur Unterstützung der Dissidenten: Hans Dieter Zimmermann war damals Sekretär der Abteilung Literatur der West-Berliner Akademie der Künste. Die Reise nach Prag veränderte sein Leben. Er lernte nicht nur Václav Havel und Pavel Kohout kennen, sondern auch seine zukünftige Frau. Immer wieder fuhr er nach Prag, bis er Ende 1973 festgenommen und abgeschoben wurde. Acht Jahre durfte er nicht einreisen. Seine Verlobte musste zwei Jahre warten, bis sie die Ausreise erhielt.
Die deutsche und die tschechische Literatur Böhmens wurden zentrale Themen für Zimmermann. Er war Geschäftsführender Herausgeber der Tschechischen Bibliothek in deutscher Sprache, die immerhin auf 33 Bände kam. Seine Erkenntnisse zu Franz Kafka fasste er in dem Band „Kafka für Fortgeschrittene“ zusammen.
Hans Dieter Zimmermanns Erinnerungen sind in ihrer zweiten Hälfte „tschechisch“: Sie enthalten die Geschichte seiner Schwiegereltern, die beide Verfolgte des Naziregimes waren und auch unter den Kommunisten litten. Und Porträts von Freunden wie Lenka Reinerová oder Peter Demetz. Zimmermann war von 1975 bis 1987 Professor für neuere deutsche Literatur an der Goethe-Universität Frankfurt und von 1987 bis 2008 an der TU Berlin. 2000 erhielt er von Präsident Václav Havel den Tomáš-Garrigue-Masaryk-Orden.
Umrahmt wird die Veranstaltung durch Violinstücke von Antonín Dvořák, gespielt von Victoria Klin (Violine) und Janka Simowitsch (Klavier).
Eintritt: 10 €
Eine Veranstaltung des Sudetendeutschen Musikinstituts in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder
Donnerstag, 4. Mai 2023
19.00 Uhr
Der Verlag Volk und Reich in Prag
Wissenschaftlicher Vortrag von Murray G. Hall
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
1940 eröffnete der Berliner Verlag Volk und Reich eine Niederlassung im besetzten Prag, im selben Jahr erschien dort erstmals die Zeitschrift Böhmen und Mähren. Blatt des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren. Den Verlag hatte der 1897 in Pilsen geborene Friedrich Heiß 1925 gegründet. Sozialisiert in der bündischen Jugend, ab den 1930er Jahren in wichtigen Rollen in der Hitlerjugend und im Stab des Reichsjugendführers Baldur von Schirach tätig, gab er selbst die völkische Zeitschrift Volk und Reich heraus, die seit Mitte der 1930er Jahre gegen die Tschechoslowakei agitiert hatte.
In Prag erschienen u.a. Werke von Leo Hans Mally, Hugo Scholz und Hans Watzlik, die Firma prosperierte und übernahm in den folgenden Jahren mehrere Firmen im Protektorat und im Reichsgau Niederdonau. In zahlreichen Buchreihen, auch für spezielle Zielgruppen wie die Wehrmacht (Prager Feldpostbücherei) oder die Organisation Todt (Die Bücher des Frontarbeiters), wurden Klassiker und Ratgeberliteratur verlegt, aber auch spezifisch sudetendeutsche Autoren und kulturgeschichtliche Werke.
Der Wiener Buchwissenschaftler Murray G. Hall (Österreichische Verlagsgeschichte 1918–1938, 1985; Der Paul Zsolnay Verlag. Von der Gründung bis zur Rückkehr aus dem Exil, 1994; „… allerlei für die Nationalbibliothek zu ergattern …“. Eine österreichische Institution in der NS-Zeit, mit Christina Köstner 2006), der seit Jahren neben der österreichischen auch die böhmische Verlagsgeschichte aufarbeitet, hat 2021 den Band Der Volk und Reich Verlag, Prag. Zur Geschichte des Buchhandels und Verlagswesens im Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945 veröffentlicht.
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins in Kooperation mit der Buchwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München
25.-27. April 2023
Di, 18.00 Uhr | Mi, 16.00 Uhr | Do, 17.00 Uhr
Waldgeheimnisse in Böhmerwald und Isergebirge
Literatur im Café: Rosa Tahedl und Gustav Leutelt
1. Bildungs- und Konferenzzentrum Kloster Haindorf/Hejnice (in tschechischer Sprache)
2. Begegnungszentrum, Ruprechtická 254, Reichenberg/Liberec (in deutscher Sprache)
3. Haus der Verständigung, Československé armády 24, Reinowitz /Rýnovice (in tschechischer Sprache)
Die Veranstaltungsreihe Literatur im Café reist nach Tschechien und präsentiert deutsche Literatur aus Böhmen in tschechischer Sprache.
Anna Knechtel (ASV) stellt zwei Dichter vor und liest aus ihren Texten: Gustav Leutelt und Rosa Tahedl. Aus unterschiedlichen regionalen Blickwinkeln betrachten sie ein und dasselbe Phänomen: den Wald. Das waldbedeckte Isergebirge in Nordböhmen war die Heimat Gustav Leutelts (1860–1947), Rosa Tahedl (1917–2006) stammte hingegen aus dem Böhmerwald, dem „grünen Dach Europas“.
Ihre Erfahrungen lassen zwar Unterschiede erkennen – sei es aufgrund ihres persönlichen Umfelds, sei es aufgrund ihrer Lebensdaten. Doch beide haben den Wald als prägend für ihre Existenz empfunden, nicht nur in wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht, sondern auch als geheimnisvollen „Tröster und Ruhespender“ (Leutelt) oder als Sinnbild des Schicksals, „das sich nicht wählen, nur ertragen läßt“ (Tahedl).
Begrüßungen: Jan Heinzl und Petra Laurin
Weitere Leser: Blažena Hušková und Jarmila Wernerová (tschechisch), Christa Petrásková und Roman Klinger (deutsch).
Eintritt jeweils frei
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Begegnungszentrum Klášter Hejnice, dem Haus der deutsch-tschechischen Verständigung und dem deutsch-tschechischen Begegnungszentrum Reichenberg
Freitag, 31. März 2023
18.00 Uhr
Eva Habel: Zu Gast bei den Roma in Schluckenau
Buchpräsentation
HDO-Gaststätte „Zum Alten Bezirksamt“, Am Lilienberg 5, München
Dass Liebe durch den Magen geht, ist bekannt. Dies war wohl auch für Eva Habel ein Grund, ein Kochbuch der Roma herauszubringen, die seit vielen Jahrzehnten im Schluckenauer Zipfel in Nordböhmen leben. Die Schluckenauer Roma kamen ursprünglich aus verschiedenen Teilen der einstigen Donaumonarchie und wurden nach 1945 in der kommunistischen Tschechoslowakei in die Grenzregion umgesiedelt. Von überall her brachten sie auch ihre Rezepte mit, wobei viele davon den Sudetendeutschen ebenfalls vertraut sein dürften.
So entstand ein hochinteressantes Buch mit vielen Kochanleitungen für Süßes und Herzhaftes. Dazwischen finden sich Erinnerungen und Bilder aus dem althergebrachten Leben der Schluckenauer Roma. Somit führt das Buch nicht nur in ihre Küche, sondern auch in ihre Lebenswelt ein. Indem es in den Lebensgeschichten der Roma die Wechselwirkungen mit der Mehrheitsgesellschaft reflektiert, schließt es eine große Wissenslücke über diese Minderheit.
Das Kochbuch Zu Gast bei den Roma in Schluckenau wurde vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, dem Bundesjustizministerium, dem Regierungsamt der Tschechischen Republik, Renovabis und dem Bistum Eichstätt gefördert. Es erscheint auf Tschechisch, Deutsch und Romanes.
Eva Habel ist Direktorin der regionalen Caritas Schluckenau/Šluknov (Tschechien). Von 1999 bis 2008 war sie Heimatpflegerin der Sudetendeutschen. Seit 2008 ist sie als Pastoralreferentin der Caritas für die Roma-Minderheit in Schluckenau tätig. Sie kümmert sich vor allem um Roma-Familien, die in schwierigen Verhältnissen leben. Mit Hilfe des Leitmeritzer Bischofs Jan Baxant gründete sie eine Gebietsdirektion. Dank der Unterstützung aus Deutschland realisierte sie zahlreiche Projekte, um die Situation der Menschen zu verbessern. Auch Koch- und Backkurse für Romakinder und -jugendliche stehen auf ihrem Programm.
Die Teilnehmerrzahl ist auf 30 begrenzt. Anmeldung nötig unter poststelle@hdo.bayern.de
Unkostenbeitrag 20 Euro/Person bei Verkostung von drei Gerichten aus dem Kochbuch.
Eine Veranstaltung des Hauses des Deutschen Ostens in Kooperation mit der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen und dem Kulturreferat für böhmische Länder im Adalbert Stifter Verein
Sonntag, 26. März 2023
19.00 Uhr - leider ausgebucht
Auf ein Bier mit Jaroslav Rudiš
Lesung und Gespräch
Bufet, Dachauer Str. 7a, München
Nächster Halt … Bufet: Der Erfolgsautor und überzeugte Bahnfahrer Jaroslav Rudiš stellt in Münchens kultigster Bahnhofskneipe seine Ode an die Eisenbahn Gebrauchsanweisung fürs Zugfahren (Piper 2021) vor. Im Gepäck auch dabei: sein Roman Winterbergs letzte Reise (Luchterhand 2019) und die Graphic Novel Nachtgestalten (Luchterhand 2021, gemeinsam mit Nicolas Mahler).
Jaroslav Rudiš (*1972 in Turnov) ist Roman-, Drehbuch- und Comicautor und schreibt sowohl auf Tschechisch als auch auf Deutsch. Für sein Werk und seinen Beitrag zur Verständigung zwischen Deutschland und Tschechien erhielt er zahlreiche Preise und Auszeichnungen, darunter 2014 den Usedomer Literaturpreis, 2018 den Preis der Literaturhäuser, 2021 den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland sowie 2022 den Karel-Čapek-Preis.
Anmeldung hier.
Eintritt: 7 € (inkl. Willkommensgetränk) an der Abendkasse.
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins und des Tschechischen Zentrums München
Donnerstag, 23. März 2023
19.00 Uhr
Das Thema: Erika Mann?
Theateraufführung
Saal X, HP8 – Gasteig, Hans-Preißinger-Str. 8, München
„Wir haben nichts als unsere eigene Stimme und Person … und die ‚Pfeffermühle‘ wäre glücklich, wenn sie ihr winziges, winziges, winziges Teilchen dürfte beigetragen haben zum Sieg der Besinnung und der Vernunft in Europa.“ (Erika Mann)
Die Prager Theatergruppe Das Thema hat sich Erika Mann zum Thema genommen. Erika Mann war selbst Kabarettistin und Schauspielerin, aber auch Kriegsreporterin und Schriftstellerin. Die Truppe erforscht diese witzige, scharfe und eigenwillige Persönlichkeit zusammen mit dem Publikum: Wer war sie, was bewegte sie, und wie nutzte sie ihre Kunst im Kampf gegen den Faschismus?
Das Programm ihres Kabaretts Pfeffermühle und dessen mehrjährige Tour durch Europa (mehrmals auch durch die Tschechoslowakei) sind Ausgangspunkt der Annäherung. Damals wollte es seinem Publikum die Augen öffnen und zeigen, wer Hitler und die Nazis wirklich waren. Damals waren sie das große Böse, aber womit kämpfen wir heute, und wie kann uns ihre Arbeit dabei noch heute inspirieren?
Das Thema arbeitet mit biografischen Fragmenten, Zitaten aus Gesprächen, Büchern, Briefen und Originaltexten der Pfeffermühle und reagiert mit eigenen Texten auf Erika Manns Leben, Ansichten und die Pfeffermühle.
Dauer der Vorstellung: 75 Minuten ohne Pause
Es spielen: Roman Horák, Stefanie Jörgler, Markéta Richterová, Philipp Schenker
Konzept, Musik: Roman Horák, Stefanie Jörgler, Markéta Richterová und Philipp Schenker
Regie: Emil Rothermel
Kostüme: Agáta Molčanová
Videoprojektion: Vojtěch Polák, Stefanie Jörgler
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=W71hmN6cghc
Eintritt: 10 Euro (7 Euro ermäßigt) über München Ticket
Veranstalter: Adalbert Stifter Verein, Monacensia im Hildebrandhaus und Münchner Stadtbibliothek
Die Vorstellung „Das Thema: Erika Mann?“ wurde vom Goethe-Institut im Rahmen der Monacensia-Ausstellung „Erika Mann – Kabarettistin – Kriegsreporterin – Politische Rednerin“ initiiert und wird durch den Adalbert Stifter Verein unterstützt.
Donnerstag, 16. März 2023
19.00 Uhr
Flucht und Vertreibung
Buchpräsentation
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
Flucht und Vertreibung führen an verschiedenen Orten der Welt seit Jahrhunderten zu großem persönlichem Leid. Das Thema war und ist stets aktuell. Die individuellen Schicksale der Menschen, die aus ihrem Leben gerissen werden und vor Gewalt und Zerstörung fliehen müssen, lösen große Betroffenheit aus. Gleichzeitig sind die Integration der Geflüchteten sowie die Verarbeitung der persönlichen Schicksale eine Herausforderung.
Werner Sonne und Thomas Kreutzmann haben sich in ihrem Buch Schuld und Leid. Das Trauma von Flucht und Vertreibung 1945–2022 diesem Thema mit einem besonderen Fokus gewidmet: 14 Millionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene haben nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Heimat verloren. Ihre Integration war eine der größten Herausforderungen für die junge Bundesrepublik. Die Autoren zeigen, wie die Debatten über die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und an Flucht und Vertreibung das Selbstverständnis der Deutschen und ihres Gemeinwesens beeinflussen.
Werner Sonne war lange Jahre beim Westdeutschen Rundfunk tätig, als stellvertretender Chefredakteur für die Landesprogramme, als ARD-Korrespondent in Bonn, Hamburg und Berlin und als ARD-Studioleiter in Washington und Warschau. Er ist Autor von Romanen und politischen Sachbüchern.
Thomas Kreutzmann arbeitete über 40 Jahre als Korrespondent für die ARD und den Hessischen Rundfunk, darunter in Prag und Madrid sowie über zehn Jahre im ARD-Hauptstadtstudio Berlin. Kreutzmann hat zahlreiche familiäre Bezüge ins frühere Sudetenland und nach Pommern.
Moderation: Wolfgang Schwarz
Eintritt frei
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder und der Kulturreferentin für den Donauraum
Donnerstag, 9. März 2023
18.00 Uhr
Ankommen im Dialekt
Vortrag von Klaas-Hinrich Ehlers über Vertriebene aus den böhmischen Ländern, Schlesien und der Slowakei als Lerner des mecklenburgischen Plattdeutsch
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
Der Linguist Klaas-Hinrich Ehlers stellt die Ergebnisse seiner langjährigen Forschung zur sprachlichen Integration der Vertriebenen in Mecklenburg und der Entwicklung der Dialekte vor.
Unter den vielen deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Norddeutschland angesiedelt wurden, war auch eine große Zahl von Menschen aus den böhmischen Ländern, aus Schlesien und der Slowakei. Wie arrangierten sich diese Menschen aus mittel- und oberdeutschen Herkunftsgebieten sprachlich mit ihrem neuen Lebensumfeld, das damals noch stark vom Niederdeutschen (also Plattdeutschen) geprägt war? Die übliche Antwort auf diese Frage lautet: Die immigrierten Vertriebenen ebenso wie die alteingesessenen Norddeutschen nahmen vom Gebrauch ihrer jeweiligen Dialekte rasch Abstand und trafen sich sprachlich im überregionalen Hochdeutschen.
Umfangreiche Zeitzeugenbefragungen in Mecklenburg-Vorpommern zeigen dagegen ein anderes Bild. Demnach passten sich viele der Zuwanderer sprachlich an ihr neues Sprachumfeld an, indem sie das mecklenburgische Niederdeutsch lernten und sprachen. Der Vortrag fragt nach dem Umfang des Niederdeutscherwerbs bei Vertriebenen und beleuchtet die Rahmenbedingungen und Motive für das Erlernen des norddeutschen Dialekts. Grundlage der Untersuchung sind 90 Zeitzeugeninterviews und Sprachtests, die 2010 bis 2015 in der Umgebung von Rostock durchgeführt wurden und in der gerade erschienenen zweibändigen Geschichte der mecklenburgischen Regionalsprache seit dem Zweiten Weltkrieg (Verlag Peter Lang) ausgewertet wurden.
Eine Veranstaltung des Collegium Carolinum in Kooperation mit dem Adalbert Stifter Verein
Sonntag, 5. März 2023
17.00 Uhr
Poslední závod. The Last Race
Filmvorführung im Rahmen des Mittel-Punkt-Europa-Filmfests
Filmmuseum München, St.-Jakobs-Platz 1, München
Das Riesengebirge am Vorabend des Ersten Weltkriegs: Der hochtalentierte Skilangläufer Bohumil Hanč ist in Bestform. Erstmals wird er in einem Ski-Rennen seine Kräfte auch mit deutschen Kontrahenten messen dürfen. Doch dann kommt es zu einem tragischen Zwischenfall. Mehr als fünfzig Jahre später wird der deutsch-böhmische Sportler Emmerich Rath einer Berghütte als Heizer zugewiesen. Die dorthin strafversetzten tschechischen Pächter sind wenig begeistert. Nur langsam wird ihnen klar, mit wem sie es zu tun haben und welche Rolle er bei Hanč’ letztem Ski-Rennen spielte. In dem bildgewaltigen Sportdrama treffen Berg- und Geschichtspanoramen aufeinander und legen Zeugnis über die Wechselfälle des deutsch-tschechischen Zusammenlebens ab.
Im Anschluss Filmgespräch mit dem Standfotografen Nikolas Tušl
Regie: Tomáš Hodan. Mit: Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser, Judit Bardós, Jan Nedbal
CZ 2022, 102 Min., OmeU
Eintritt: 5 €
Eine Veranstaltung des Mittel Punkt Europa Filmfestivals und des Tschechischen Zentrums München in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder
Dienstag, 28. Februar 2023
19.00 Uhr
Tschechien erlesen. Deutsch-tschechische Familiengeschichten
Lesung und Gespräch mit Alice Horáčková a Veronika Jonášová
Tschechisches Zentrum, Prinzregentenstraße 7, München
In den letzten Jahren war das Zusammenleben von Deutschen und Tschechen im 20. Jahrhundert in Tschechien wiederholt ein großes Thema, in Kunst, Film und Literatur. Nachdem die Aufarbeitung der tabuisierten Wendepunkte des 20. Jahrhunderts, durch die dieses Zusammenleben in die Brüche ging, weit fortgeschritten ist, konzentrieren sich Autorinnen und Autoren nun auf das Private und gehen auch in der eigenen Familiengeschichte auf Spurensuche. So auch Alice Horáčková in ihrem Roman Rozpůlený dům (Ein geteiltes Haus, 2022) und Veronika Jonášová in Ada (2022). Beide Bücher stellen die Vorstellung von einer einfachen – nationalen – Identität und eine traditionelle Auslegung der Geschichte in Frage. Was hat die beiden Schrifstellerinnen motiviert, derart persönliche Texte zu schreiben? Wie lief die Spurensuche in der eigenen Familie? Und was haben sie über sich selbst, aber auch über das Land, in dem sie leben, erfahren?
Moderation: Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein)
Alice Horáčková (geboren 1980) ist Journalistin und Schriftstellerin. Sie veröffentlichte eine Biografie über die Beatnik-Dichterin Vladimíra Čerepková (2014) und sprach in 7x ve vedlejší úloze (7x in der Nebenrolle, 2016) mit Geschwistern von bekannten Menschen, wie Ivan M. Havel, Helena Landovská oder Jana Navrátilová. Rozpůlený dům (Ein geteiltes Haus, 2022) ist ihr zweites belletristisches Buch, ein vielstimmiger Familienroman, in den sie Familiengeschichten, Erinnerungen und Archivdokumente einfließen lässt. Ein Roman, der die Lebenswelt eines Dorfes im Riesengebirge vor und während des Zweiten Weltkriegs schildert und die Unzulänglichkeit der nationalen Zuweisungen angesichts der Anforderungen, die das Leben an die Menschen stellt, eindeutig vor die Augen führt.
Veronika Jonášová (geboren 1982) ist Journalistin und schreibt aktuell für die tschechische Ausgabe der Zeitschrift Forbes. Sie arbeitete als Reporterin und Moderatorin im Tschechischen Fernsehen, von 2019 bis 2022 lebte sie in Berlin. Ada (2022) ist ihr belletristisches Debüt, in dessen Mittelpunkt eine junge Fernsehjournalistin steht, die eher zufällig auf die deutschen Wurzeln ihrer Familie stößt. Nach und nach wird die Nachkriegsgewalt an der deutschen Bevölkerung unweit Olmütz/Olomouc aufgedeckt; der Urgroßvater ist im Internierungslager Hodolein/Nové Hodolany, genannt Hodoleiner Hölle, umgebracht worden. Auch hier fließen Zeugenberichte und Erinnerungen ein und ergänzen die unbekannte Geschichte einer geteilten Familie.
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, des Deutschen Kulturforums östliches Europa und des Tschechischen Zentrums München.
Dienstag, 28. Februar 2023
19.30 Uhr
Arnošt Lustig: Tacheles
Buchvorstellung mit Karel Hvížďala
Bar und Buchhandlung "sphères", Hardturmstraße 68, Zürich
Der tschechisch-jüdische Schriftsteller Arnošt Lustig gewährte dem Journalisten Karel Hvížďala in den Jahren 2010 und 2011 kurz vor seinem Tod in mehreren Gesprächen Einblick in sein bewegtes Leben. Lustig, Überlebender der Schoah, spricht in dem Buch Tacheles in bemerkenswerter Offenheit u. a. über die Zeit in Konzentrationslagern, über die Bedeutung des Judentums im 21. Jahrhundert oder über seine Freunde, die Schriftsteller Ota Pavel und Ludvík Aškenázy sowie den Piloten Josef Plaček.
Karel Hvížďala gehört zu den bekanntesten Journalisten, politischen Kommentatoren und Essayisten Tschechiens. Von 1978 bis 1990 lebte er im Exil in Deutschland. Seine Veröffentlichungen, oft auch in Form von Gesprächen, beschäftigten sich u. a. mit Václav Havel, Jiří Gruša oder Karol Efraim Sidon. In Zürich stellt er sein in mehreren Auflagen erschienenes Buch dem Schweizer Publikum vor.
Ein weiterer Gast des Abends ist Lustigs Tochter Eva Lustigová. Sie leitet den Stiftungsfonds Arnošt Lustig, der sich für die Vermittlung humanistischer Werte und Traditionen engagiert und somit das Werk des Autors in seinem Sinne fortführt.
Der Abend findet in tschechischer Sprache statt.
Moderation: Wolfgang Schwarz
Eintritt frei, Spenden erbeten
Eine Veranstaltung des Český klub Zürich in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder
Donnerstag, 16. Februar 2023
19.00 Uhr
Hannah. Ein gewöhnliches Leben
Kurzvortrag, Filmvorführung und Gespräch
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
Vor mehr als siebzig Jahren, im November 1952, wurden in der Tschechoslowakei im sogenannten Slánský-Prozess elf Mitglieder der Kommunistischen Partei, fast alle Juden, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Sie wurden des „staatsfeindlichen Zionismus“ und der wirtschaftlichen Sabotage bezichtigt. Mit diesem Schau-Prozess wird die antisemitistische Prägung des totalitären Regimes deutlich, ganz nach dem sowjetischen Muster.
Auch Ludvík Frejka, der einer sudetendeutschen jüdischen Familie entstammte, im Londoner-Exil den 2. Weltkrieg überlebte und danach Sekretär der Zentralen Planungskommission war, erhielt ein Todesurteil. Seine damals siebenjährige Tochter Hana und ihre Mutter Elisabeth, eine aus Hamburg stammende Schauspielerin, wurden aus Prag ins Sudetenland, in die Gegend von Liberec/Reichenberg, ausgewiesen.
Bis heute setzt sich Hana Frejková mit ihrem familiären Trauma auseinander. Der halbstündige Dokumentarfilm Hannah - Ein gewöhnliches Leben zeigt, wie Frejková, eine erfolgreiche Sängerin und Schauspielerin, ihr autobiographisches Theaterstück HANNAH inszeniert, nach ihrer Identität sucht und einen literarischen Dialog mit ihrer Mutter führt.
Martin Schulze Wessel (Collegium Carolinum) ordnet in seinem Kurzvortrag die Slánský-Prozesse in den geschichtlichen Kontext ein.
Nach dem Film findet ein Gespräch mit Hana Frejková statt, moderiert von Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein).
Eintritt frei
Eine Veranstaltung des Adalbert Stifter Vereins, des Collegium Carolinum und der Petra-Kelly-Stiftung.
Donnerstag, 9. Februar 2023
19.00 Uhr
Schön und gewaltig
Musikalische Lesung mit Texten zur Natur in der deutschböhmischen Literatur
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
Immer wieder sind Naturgewalten, aber auch die Schönheit der Natur Gegenstand von literarischen Werken aus den böhmischen Ländern. Die Schauspielerin Susanne Schroeder, bekannt durch zahlreiche Theater- (u. a. Münchner Kammerspiele und Residenztheater) und Fernsehrollen, aber auch als Sprecherin für Rundfunk und Hörbücher, liest literarische Texte u. a. von Adalbert Stifter, Gustav Leutelt, Josef Mühlberger und Karel Klostermann. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von Jana Bezpalcová (Akkordeon).
Eintritt frei
Begleitveranstaltung zur Ausstellung Mensch, Natur und ihre Katastrophen. Historische Fotografien aus Böhmen aus der Sammlung Scheufler
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München
Mittwoch, 1. Februar 2023
19.00 Uhr
Wilder Than Wilderness (Planeta Česko)
Filmvorführung
Arena Filmtheater, Hans-Sachs-Straße 7, München
An vielen einst von Menschenhand zerstörten Orten in Tschechien gewinnt nun wieder die Natur die Oberhand. Ehemalige Braunkohlereviere, Abraumhalden, verlassene alte Bahnhöfe – auf den ersten Blick nicht gerade ein Paradies für selten gewordene Tiere und Pflanzen. Doch ausgerechnet dort, wo sich Menschen nicht mehr aufhalten, kehren Flora und Fauna oft im großen Stil zurück. Ein bildgewaltiger Filmessay über Artenvielfalt und die Resilienz der Natur.
Regie: Marián Polák. CZ 2017, 82 Min., OmeU
Eintritt: 8,50 €
Begleitveranstaltung zur Ausstellung Mensch, Natur und ihre Katastrophen. Historische Fotografien aus Böhmen aus der Sammlung Scheufler
Eine Veranstaltung des Tschechischen Zentrums München in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder
Dienstag, 31. Januar 2023
19.00 Uhr
Berhard Blöchl: Ein Buch in fünf Objekten
Lesung und Gespräch
Tschechisches Zentrum, Prinzregentenstraße 7, München
Ein Dorf am Wald. Eddie wächst unter schwierigen Bedingungen auf. Der Vater trinkt, die Mutter träumt von Bella Italia, einziger Halt ist Oma Elfie aus dem Sudetenland. Es sind die frühen Neunziger, als es Eddie reicht. Er haut ab. Doch dann geht es seiner Großmutter zu Hause immer schlechter, und statt nach Los Angeles brettert Eddie nach Prag, denn ihm und seiner Großmutter kann nun nur noch einer helfen: Karel Gott. Anhand von fünf Objekten stellt Bernhard Blöchl seinen neuen Roman Eine göttliche Jugend (Volk Verlag, 2022) vor.
Bernhard Blöchl ist Kulturredakteur der Süddeutschen Zeitung, nebenbei schreibt er auch Romane. Die Tragikomödie Eine göttliche Jugend ist sein dritter, bisher persönlichster Roman. Davor erschienen Im Regen erwartet niemand, dass dir die Sonne aus dem Hintern scheint (Piper, 2017) und Für immer Juli (MaroVerlag, 2013).
Moderation: Frances Jackson
Eintritt frei
Eine Veranstaltung des Tschechischen Zentrums München in Kooperation mit dem Kulturreferat für die böhmischen Länder
Donnerstag, 26. Januar 2023
19.30 Uhr
Zum Adalbert-Stifter-Gedenktag: Adalbert Stifter Briefe
Buchpräsentation, Lesung, feierliche Übergabe der Leihgabe des Adalbert Stifter Vereins
StifterHaus, Adalbert-Stifter-Platz 1, 4020 Linz
Präsentation der in der Historisch-kritischen Stifter-Ausgabe erschienenen Briefbände durch die Herausgeber Hartmut Laufhütte und Werner Michler und den Zentralredaktor Johannes John.
Einführung: Petra-Maria Dallinger
Überreichung eines Briefes von Adalbert Stifter vom 31.8.1857 an seinen Verleger Gustav Heckenast als Leihgabe durch Peter Becher und Zuzana Jürgens (Adalbert Stifter Verein München).
Lesung „Adalbert Stifter im Briefwechsel mit Frauen“ mit Maria Hofstätter und Florentin Groll.
Mehr als eintausend Briefe Adalbert Stifters (an Freunde, Kollegen, seinen Verleger, seine Frau und andere) sind überliefert und werden im Rahmen der Historisch-kritischen Ausgabe – ebenso wie Briefe an den Dichter – neu ediert. Die bisher erschienenen Bände werden am Abend präsentiert. Enthalten sind Briefe an Stifters Ehefrau Amalia, aber auch an Schriftstellerkolleginnen wie Emilie von Binzer, Marie von Hrussoczy (Mariam Tenger), Betty Paoli und Ottilie von Wildermuth sowie an die Dichterschwester Luise von Eichendorff. Die Schauspieler Maria Hofstätter und Florentin Groll lesen ausgewählte Briefe.
Ein vom Adalbert Stifter Verein München 2021 von einem privaten Besitzer erworbener Brief Stifters an seinen Verleger Gustav Heckenast mit Korrekturanweisungen zum Roman Der Nachsommer wird dem Adalbert-Stifter-Institut im Rahmen der Veranstaltung als Dauerleihgabe überreicht.
Johannes John, geboren 1957. Studium der Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaft in München. Seit 1997 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Kommission für Neuere deutsche Literatur der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (München), dort Zentralredaktor und Bandherausgeber innerhalb der Historisch-kritischen Ausgabe der Werke und Briefe Adalbert Stifters. Seit 1987 Lehrbeauftragter am Institut für deutsche Philologie der Universität München.
Hartmut Laufhütte, geboren 1937. 1980 bis 2001/02 Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Passau. Mitglied des Adalbert-Stifter-Instituts Linz, Mitglied der Kommission für Neuere Deutsche Literatur der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Mitherausgeber u. a. der Historisch-kritischen Ausgabe der Werke und Briefe Adalbert Stifters.
Werner Michler, geboren 1967 in Wien. Studium der Germanistik und Philosophie an der Universität Wien. Seit März 2013 Universitätsprofessor für Neuere Deutsche Literatur am Institut für Germanistik der Universität Salzburg. Mitarbeit an der Historisch-kritischen Ausgabe der Werke und Briefe Adalbert Stifters.
Florentin Groll, geboren 1945 in Vöcklabruck. Schauspieler, Sprecher und Theaterregisseur, Theater-Engagements u. a. in Wien, Dortmund, Bonn, Tübingen, Darmstadt, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und Düsseldorf. 1979 wurde er ans Wiener Burgtheater engagiert, wo er bis 2010 Ensemblemitglied war.
Maria Hofstätter, geboren 1964 in Linz. Zunächst Kabarett-Duo mit Josef Hader. dann Theater-Engagements u. a. am Theater Phönix Linz, Stadttheater Klagenfurt, Theater der Jugend Wien, Theater Hausruck Oberösterreich, Volksbühne Berlin. Seit 1995 Leitungsteam Projekttheater Vorarlberg. Spielfilme (Auswahl): Indien (Paul Harather), Die Ameisenstraße (Michael Glawogger), Hundstage (Ulrich Seidl), Wolfszeit (Michael Haneke), Hurensohn (Michael Sturminger), Sophie Scholl – Die letzten Tage (Marc Rothemund), Paradies: Glaube (Ulrich Seidl), Fuchs im Bau (Arman T. Riahi).
Eintritt frei
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Adalbert-Stifter-Institut Linz
Dienstag, 17. Januar 2023
18.00 Uhr
Mensch, Natur und ihre Katastrophen
Historische Fotografien aus Böhmen
Ausstellungseröffnung
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
Naturkatastrophen steht und stand der Mensch oft machtlos gegenüber. Häufig hat er sie jedoch mit verursacht: Hochwasser ist auch bedingt durch Überregulierung einst freilaufender Flüsse. Erdrutsche sind Folgen extremer Niederschläge, die – ebenso wie Stürme oder Windhosen – durch den Klimawandel zunehmen. Luftverschmutzung schädigt seit vielen Jahrzehnten Wälder und Ackerböden.
Die Ausstellung mit historischen Fotografien aus der Sammlung Scheufler thematisiert Naturkatastrophen in den böhmischen Ländern. Fast alle Aufnahmen stammen aus der Zeit der k. u. k. Monarchie im Zeitraum 1870–1918. Renommierte Fotografen ihrer Zeit wie Rudolf Bruner-Dvořák oder František Krátký fingen die Folgen der Kraft von Wind, Wasser oder Feuer in verschiedenen böhmischen Regionen ein. Die durch Hochwasser 1890 partiell eingestürzte Prager Karlsbrücke ist ebenso zu sehen wie von Erdrutschen beschädigte Häuser im Riesengebirge oder vom Tagebau verursachte Schäden in Brüx/Most. Die Rolle des Menschen wird dabei kritisch gewürdigt, und es wird im Kontext des aktuellen Klimawandels zum Nachdenken angeregt.
Einführung: Pavel Scheufler (Kurator der Ausstellung)
Ausstellungsdauer: 18.1. bis 31.3.2023
Geöffnet: Mo–Fr 10–18 Uhr
Eintritt frei
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum München