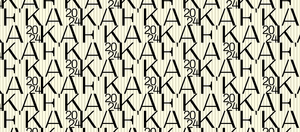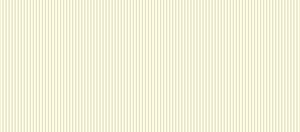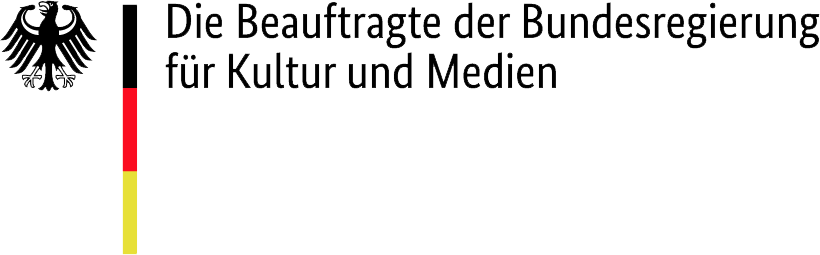The standpoint of a nation’s art
always is the standpoint
of a nation’s humanity.
Adalbert Stifter
Veranstaltungen

21.–22. September 2024
Sa | 13.00 Uhr
Böhmerwaldseminar
Tagung zu Kriegsende und Vertreibung vor 80 Jahren in Böhmen
Schloss Gratzen, Nové Hrady 1, Nové Hrady
Das Böhmerwaldseminar versteht sich als grenzüberschreitendes Forum für aktuelle Themen, Projekte und Akteure der deutsch-tschechischen kulturhistorischen Beziehungen. In Nové Hrady werden im Vorgriff auf das Gedenken an 80 Jahre Kriegsende Beiträge zu den letzten Kriegswochen sowie zur anschließenden Vertreibung u. a. auch mit einem Schwerpunkt in Südböhmen angeboten. Vorgestellt werden auch aktuelle Buch- und Interview-Projekte, die sich mit dieser Zeit, aber auch mit den Folgen für die heute in den einstigen Sudetengebieten lebenden Menschen auseinandersetzen.
Präsentiert wird der in der ČSSR kulturpolitisch liberaleren sechziger Jahren entstandene Film Kočár do Vídně (Wagen nach Wien, 1966) von Karel Kachyňa, der seinerzeit wegen der kritischen Darstellung tschechoslowakischer Partisanen und der partiell sympathischen Zeichnung eines deutschen Soldaten Aufsehen erregte. Nach 1968 wurde er verboten.
Teilnahmegebühr: 125 €/1 300 Kč
Anmeldung erforderlich unter sekretariat@stifterverein.de
Hier geht's zum kompletten Programm >>
Eine Veranstaltung des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit der Stadt Nové Hrady
3.–4. Oktober 2024
Do 14.45 Uhr
Franz Kafka, Adolf Loos und Pilsner Urquell
Stadtbesuch nach Pilsen
Treffpunkt: Západočeská galerie v Plzni – Ausstellungssaal Masné krámy, Pražská 18, Pilsen
Führungen durch die Ausstellung Mit Kafkas Augen. Zwischen Bild und Sprache, die Semler-Residenz und die Brauerei Pilsner Urquell.
Bis zum 28. Oktober wird in der Westböhmischen Galerie in Pilsen die Ausstellung Mit Kafkas Augen. Zwischen Sprache und Bild gezeigt, die in Zusammenarbeit mit dem Adalbert Stifter Verein – Kulturinstitut für die böhmischen Länder entstanden ist. Dies nehmen wir zum Anlass, einen Stadtbesuch in die westböhmische Metropole zu organisieren, die auch weitere kulturelle und kulinarische Schätze zu bieten hat. Im Mittelpunkt steht eine kommentierte Führung durch die Kafka-Ausstellung, ergänzt durch Besichtigungen dreier Interieure von Adolf Loos, die sich in Pilsen erhalten haben, und eine Führung durch die Pilsner Brauerei.
Begrenzte Teilnehmerzahl. Anreise erfolgt eigenständig. Ein Zimmerkontingent im Hotel Central in Pilsen ist reserviert, die Buchung erfolgt ebenfalls selbstständig.
Programm:
3. Oktober
14.45 Treffpunkt vor dem Ausstellungssaal Masné Krámy, Pražská 18, Pilsen
15.00–17.00 kommentierte Führung durch die Ausstellung Mit Kafkas Augen. Zwischen Bild und Sprache
17.45 Besichtigung der Pilsner Brauerei (gemeinsamer Gang von der Ausstellung, etwa 15 Minuten)
4. Oktober
10.00 kommentierte Führung durch die Semler-Residenz
12.00–12.45 gemeinsames Mittagessen (auf eigene Kosten)
13.00–15.30 Brummel-Haus und Wohnung der Familie Vogl
Kosten: ca. 1000 Kč (Eintritt und Dolmetschen, genaue Höhe je nach Anzahl der Teilnehmer. Zahlbar in bar vor Ort)
Anmeldung erforderlich: sekretariat@stifterverein.de
In Kooperation mit der Westböhmischen Galerie in Pilsen. Im Rahmen des Projekts Kafka 2024

Mittwoch, 4. Dezember 2024
19.00 Uhr
Kafkas Stimmen
Szenische Lesung
Sudetendeutsches Haus, Hochstraße 8, München
Max Simonischek und Wiebke Puls führen durch die vielgestaltige Welt von Kafkas Sprache.
Leser, die sich intensiver mit Texten des in Prag geborenen deutschsprachigen Schriftstellers Franz Kafka (1883–1924) beschäftigen, stoßen fast zwangsläufig auf ein schwer erklärbares, widersprüchliches Phänomen. Einerseits wird ihnen Kafkas „Sound“ immer vertrauter – Stil, Tonlage, Wortschatz –, so dass sie auch bei weniger bekannten Texten seine Autorschaft schon nach wenigen Sätzen erraten können. Andererseits wird ihnen die immense sprachliche Bandbreite und Modulationsfähigkeit Kafkas immer bewusster. Dieser paradoxe Effekt ist auch aus anderen künstlerischen Bereichen bekannt, etwa bei Sängern.
Die szenische Lesung Kafkas Stimmen ist eine Komposition von originalen Textpassagen, die auch weniger erfahrenen Lesern diese Vielfalt zu Gehör bringen und sie damit zu weiterer Lektüre verführen soll. Die Lesung bietet zahlreiche Momente der Überraschung und inneren Bewegung, phantastische Einfälle und abgründige Komik.
Kafka gelingt die Traumerzählung ebenso wie der Liebesbrief und das amtliche Schreiben, der Aphorismus und die durchkomponierte Kurzprosa, die Parabel und der Slapstick, die theaterhafte Romanszene, das literarische Tagebuch und manchmal alles gleichzeitig und ineinander verschränkt, ohne dass man je das Gefühl hätte, dass der Autor die Kontrolle verliert.
Textkomposition und Einführung: Reiner Stach, Germanist und Autor einer dreibändigen Kafka-Biografie (S. Fischer, 2002–2014).
Max Simonischek absolvierte ein Schauspielstudium am Mozarteum, Salzburg. Engagements u. a. am Wiener Burgtheater, an den Münchner Kammerspielen, bei den Salzburger Festspielen. Zahlreiche Preise, darunter der Nestroy-Theaterpreis. 2015 inszenierte und spielte Max Simonischek erstmals am Zürcher Neumarkt-Theater Kafkas Der Bau; sein Stück Kafka stirbt hatte im Juni 2022 Uraufführung am Theater Innsbruck.
Wiebke Puls studierte Schauspiel in Berlin. Engagements in Hannover und Hamburg, seit 2005 an den Münchner Kammerspielen. Zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt der 3sat-Preis.
Eintritt: 12 € / 7 € (Abendkasse)
Kartenreservierung: eveeno.com/kafkas-stimmen
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Literaturhandlung München.
Gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.
Aktuelles
Stellenausschreibung: Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter Finanzen und Personalwesen (m/w/d)
Die unbefristete Vollzeitstelle ist zum 1. November 2024 zu besetzen.
Ihr Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung im Bereich der Verwaltung als Kaufmann (m/w/d) für Büromanagement, Fachangestellter (m/w/d) für Bürokommunikation, Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung
- fundierte Kenntnisse in allen Bereichen der Finanzbuchhaltung
- Erfahrung mit Lexware und in der Verwaltung des öffentlichen Dienstes vom Vorteil
- Sicheres und freundliches Auftreten
- selbständiges Arbeiten
- gute Kenntnisse der Microsoft-Office-Produkte
- Bereitschaft zur gelegentlichen Teilnahme an Abendveranstaltungen
Ihre Aufgaben:
- Rechnungs- und Jahresabschlüsse
- betriebswirtschaftlichen Abrechnungen
- Verwendungsnachweise, Budgetplanungen und Kalkulationen
- eigenverantwortliche Buchhaltung und Kassenführung
- Abrechnung der Dienstreisen
- Kontrolle der externen Gehaltsabrechnung und Bereitstellung der Unterlagen
- selbständige Korrespondenz mit Krankenkassen, Versicherungen und Finanzamt
- Erfahrung im Vergabewesen von Vorteil
Wir bieten an:
- Vergütung nach TVöD E 9A (zwischen €3.449 - €4.703, je nach Berufserfahrung)
- Zuschuss zum ÖPNV
- Zusätzliche Altersvorsorge
- Teilnahme an Fortbildungen
- Unbefristete Anstellung in einem netten Team
Die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern wird gefördert. Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung werden Frauen nach dem Bundesgleichstellungsgesetz, schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des Sozialgesetzbuchs IX besonders berücksichtigt.
Bewerbung
Die Bewerbung mit den üblichen Unterlagen ist per E-Mail an sekretariat@stifterverein.de zu richten.
Kontakt:
Adalbert Stifter Verein e.V.
Hochstraße 8 81669 München
T: 622 716 30
E: sekretariat@stifterverein.de
Kafka 2024
Anlässlich des 100. Todestags des Schriftstellers und gebürtigen Pragers Franz Kafka, der sich am 3. Juni 2024 jährt, hat der Adalbert Stifter Verein ein Partner-Netzwerk und Veranstaltungsplattform Kafka 2024 ins Leben gerufen.
An vielen Orten und in vielen Veranstaltungen, in Büchern, Blogs, Podcasts und sogar Videospielen wird an ihn und sein Vermächtnis erinnert, es wird nochmal mehr deutlich, wie aktuell und inspirierend seine Texte und seine Reflexionen des Lebens und der Kunst sind. In der multikulturellen Stadt Prag in Deutsch und Tschechisch aufgewachsen, erlebte Kafka nicht nur die gegenseitige Befruchtung und Überschneidung der deutschen, tschechischen und jüdischen Kulturen, sondern auch den steigenden Nationalismus und auch Antisemitismus, Themen, die uns heute ebenfalls beschäftigen. Und nicht zuletzt achtete er zeitgemäß auf gesunden Lebensstil und Ernährung, möglicherweise ist nicht allgemein bekannt, dass er Vegetarier war.
Der Jahrestag bietet nicht nur die Möglichkeit, Kafkas Werk und Leben aus aktuellen und neuen Perspektiven zu betrachten. Das Jubiläum ist auch eine Gelegenheit, den Blick auf das tschechisch-deutsche kulturell Erbe und den gegenseitigen Austausch und Einfluss beider Kulturen und Nationen bis in die Gegenwart zu richten.
Kafka 2024 verbindet dazu bewusst die Akteure, die sich in ihrem Programm dem deutschsprachigen, in der böhmischen Metropole Prag geborenen Autoren widmen werden, insbesondere in der Tschechischen Republik, Deutschland und Österreich. Sie bringt zweisprachige Informationen über Veranstaltungen in den einzelnen Städten, über Wettbewerbe und Ausschreibungen, Hintergrundinformationen über Franz Kafka, Blogs und noch einiges mehr. Die Plattform, die im Herbst 2023 gelauncht wird, soll auch ein zentraler Punkt für Informationen über Franz Kafka und den Kontext seines Lebens und Werks sein.
Das Projekt steht unter der Schirmherrschaft des tschechischen Kulturminister Martin Baxa und der Schirmfrauschaft der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien Claudia Roth.
Es wurde vom Adalbert Stifter Verein (München) initiiert und koordiniert und entsteht in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Prag / Prag – UNESCO Stadt der Literatur. Beteiligt sind unter anderem das Goethe-Institut Prag, das Österreichische Kulturforum, die Tschechischen Zentren, das Literaturmuseum der Tschechischen Republik in Prag, Kunstforum Ostdeutsche Galerie in Regensburg, Deutsches Kulturforum östliches Europa in Potsdam, Botschaft der Tschechischen Republik in Berlin, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag, Münchner Stadtbibliothek, Literaturhaus München, Institut für Germanistik an der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität, Gesellschaft für interkulturelle Germanistik, Franz-Kafka-Gesellschaften in Prag und Wien, das Tschechische Literaturzentrum, die Westböhmische Galerie in Pilsen und Münchner Volkshochschule. Berater und Kurator einiger der Veranstaltungen ist Reiner Stach, einer der führenden Experten für Kafkas Werk und Leben.
Informationen über alle Projektpartner finden Sie hier.
Gefördert haben das Projekt die Beaftraugte der Bundesregierung für Kultur und Medien und der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds.
Abschied von František Černý
(1931–2024)
Nun hat auch er sich von uns verabschiedet, František Černý, der fast die ganze Zeit seines Lebens in Prag an der Moldau gewohnt hat, der Radius seines Lebens kaum größer als der Franz Kafkas, an den wir uns in diesem Jahr landauf, landab erinnern. Wie dieser hat Černý einige Zeit in Berlin verbracht, nicht als Schriftsteller, dem die Kehlkopferkrankung und die rasende Inflation zu schaffen machten, sondern als Gesandter und schließlich Botschafter seines Staates, dessen Amtszimmer mehr einer Gelehrtenstube als einem kühlen Diplomatenzimmer glich. Alles war aufregend und neu in diesen ersten Jahren nach dem Fall der Berliner Mauer, Ost und West wuchsen knirschend zusammen, am Potsdamer Platz streckten sich stählerne Dinosaurier in den Himmel, das Ehepaar Christo verhüllte den Reichstag, der Bundestag und das Bundeskanzleramt zogen von Bonn nach Berlin. Und Černý bewegte sich zwischen Ministern und Diplomaten ebenso traumwandlerisch leicht und ungezwungen wie zwischen Schriftstellern und Germanisten, ganz so, als ob er das seit Jahr und Tag gewohnt gewesen wäre.
Doch was wussten wir, die wir ihm damals zum ersten Mal begegneten, von seinem bisherigen Leben? Hat er je davon erzählt? Mit nicht ganz 8 Jahren erlebte er die Besetzung Prags durch die deutsche Wehrmacht, ein halbes Jahr später den Beginn des 2. Weltkriegs, mit nicht ganz 11 Jahren das Attentat auf Reinhard Heydrich und die furchtbaren Rachemaßnahmen, mit nicht ganz 14 Jahren den Prager Aufstand, das Kriegsende, die Misshandlung und Zwangsaussiedlung der Deutschen. Die kommunistische Machtübernahme erlebte er mit 17 Jahren, die Niederschlagung des Prager Frühlings im August 1968 mit 37 Jahren. Wieviel Hoffnung mag die Liberalisierung in ihm geweckt, wieviel Zuversicht der Überfall der russischen Panzer vernichtet haben? Černý hatte 20 bleierne Jahre vor sich und war bereits 58, als die Samtene Revolution das kommunistische Regime beendete. Was für ein Schicksal, und doch standen ihm die wirkungsvollsten Jahre seines Lebens noch bevor! Er wurde Gesandter und Botschafter, Vorsitzender der Union für gute Nachbarschaft und des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren.
Er nahm an unzähligen Treffen in Berlin, Dresden, Leipzig, Prag, Brünn und Budweis teil, er begleitete Lenka Reinerová zu den Begegnungen in Stifters Geburtsort Oberplan und saß dort mit den Teilnehmern bis weit nach Mitternacht singend und diskutierend zusammen. Černý war ein Menschenfreund durch und durch, und er wurde mit Preisen geehrt: Gemeinsam mit Altbundespräsident Richard von Weizsäcker erhielt er 1996 in Dresden den Kunstpreis zur deutsch-tschechischen Verständigung, 2001 nach der Beendigung seiner Botschaftertätigkeit in Berlin das Bundesverdienstkreuz, 2002 den Ricarda-Huch-Preis in Darmstadt, 2022 den Wenzel-Jaksch-Gedächtnis-Preis der Seliger-Gemeinde.
Černý zählte zu dem Kreis der bekanntesten Intellektuellen Böhmens und Mährens, zu dem so früh verstorbenen Vladimír Kafka, mit dem er das Geburtsjahr teilte, dem Vater des heutigen Botschafters der Tschechischen Republik in Berlin, zu Eduard Goldstücker und Lenka Reinerová, zu Jiří Dienstbier, Jiří Gruša und Václav Havel, die alle drei im Jahr 2011 verstorben sind, zu Ludvík Vaculík und Kurt Krolop.
Nun ist auch Černý ihnen nachgefolgt, der nie älter zu werden schien, und wir bleiben mit Trauer und Dankbarkeit zurück, dankbar ganz besonders auch für das, was er für den Adalbert Stifter Verein getan hat, und rufen ihm nach: Leb wohl, milý Franto, hab Dank für die Freundschaft, die Du uns gewährt hast und geh so leicht und heiter auf den himmlischen Pfaden weiter wie Du uns auf der Erde begegnet bist.
Peter Becher
Online Veranstaltungen
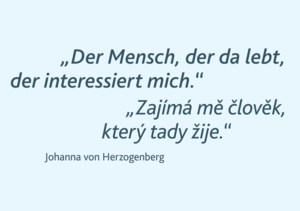
Zeitzeugen-Interviews mit Mitgliedern des böhmischen und mährischen Adels
Im Rahmen der Ausstellung Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren haben wir in Zusammenarbeit mit Post bellum/Memory of nations mit einigen Mitgliedern aus der Reihen des böhmischen und mährischen Adels über ihre Familien und auch über ihre persönliche Erfahrungen mit dem Leben im Exil, bzw. nach der Vertreibung aus ihrer Heimat gesprochen. Die Filminterviews mit Richard Belcredi, Aglaë Hagg (geb. Thun), Isabella Harnier (geb. Schwarzenberg), Johannes Lobkowicz, Georg Salm-Reifferscheidt-Raitz, Friedrich von Thun, Thomas Thun, Pater Angelus Waldstein und Maria Waldstein-Wartenberg sind nun auf dem Portal Memory of nations zu sehen.
Gefördert durch den Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds.
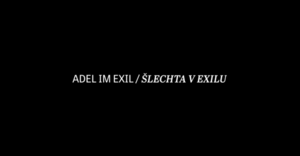
Film Adel im Exil / Šlechta v exilu
Der zweisprachige Film, in dem mehrere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen von ihren Erfahrungen berichten, ist eine persönliche und fesselnde Geschichte des böhmischen und mährischen Adels von 1918 bis heute. Er ist im Rahmen der Ausstellung des Adalbert Stifter Vereins "Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945" in Zusammenarbeit mit Memory of Nation (Post Bellum) entstanden und ist auf dem YouTube-Kanal des Adalbert Stifter Vereins zu sehen.
Neu auf Youtube:
Im Fokus: Caro Matzko
Gespräch mit der Moderatorin
YouTube-Premiere
Caro Matzko ist als Moderatorin aus Radio und Fernsehen bekannt: bei Bayern 2 in Eins zu Eins. Der Talk oder als Kolumnistin der Glosse Ende der Welt, auf dem Planet Wissen, als Sidekick in der bekannten Sendung Ringlstetter oder als Podcasterin ihrer eigenen Abendshow (ARD-Mediathek). Ihre journalistische Arbeit begann Caro Matzko schon während ihres Studiums der Kommunikationswissenschaften, Politik und Soziologie in München.
Matzkos Vater, Jahrgang 1934, stammt aus Osterode in Ostpreußen und musste als 10-jähriger seine Heimat verlassen. Ein Trauma, das Auswirkungen bis heute und auch auf Caros Leben hat: In ihrem gemeinsam mit Tanja Marfo verfassten Buch Size egal – Dein Selbstbewusstsein kann nicht groß genug sein, das sich mit ihrer Magersucht und Essstörungen auseinandersetzt, thematisiert Matzko die Bedeutung ihrer Familiengeschichte für die Krankheit und die Auswirkungen auf die eigene emotionale Stabilität. Vor allem darauf, aber auch auf viele andere Facetten ihres Lebens wird das Gespräch eingehen.
Die Matzkoʼsche Familiengeschichte wird auch eindrucksvoll von Regisseurin Maike Conway gezeigt, die das Leben und den Werdegang der Moderatorin in der BR-Reihe Lebenslinien mit dem Titel Caro Matzko – Trauriges Mädchen, witzige Frau porträtierte. Caro Matzkos Lebenslinien wurden im Mai 2023 ausgestrahlt.
Moderation: Wolfgang Schwarz

Neu auf Youtube:
Im Fokus: Ivan Liška
Interviews zu Böhmen
YouTube-Premiere
Ivan Liška, Tänzer, Choreograph und langjähriger Leiter des Bayerischen Staatsballetts, wurde in Prag geboren. Ausgebildet am Prager Konservatorium und am dortigen Nationaltheater tätig, entschloss er sich nach dem Einmarsch des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei 1968 zur Emigration. U. a. wirkte er in Düsseldorf an der Deutschen Oper am Rhein, in München am Bayerischen Staatsballett und an der Staatsoper Hamburg als Tänzer. Von 1998 bis 2016 war er Direktor des Bayerischen Staatsballets, mit dem er Tourneen zu vielen Bühnen der Welt (Prag, St. Petersburg, Madrid, Budapest etc.) durchführte.
Wolfgang Schwarz, Kulturreferent für die böhmischen Länder im Adalbert Stifter Verein, unterhält sich mit ihm über seine Eindrücke von Deutschland, seine Zeit in München, über interkulturelle Ebenen der Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen sowie über seine künstlerische Laufbahn.
Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder

Launch der Medienplattform zwischengrenzen.online
Grenzen sind ein Thema, das mit der Coronapandemie, wiederkehrenden Migrationswellen und dem Krieg in der Ukraine noch aktueller geworden ist. Mit Blogbeiträgen, einer Video-Reihe und einem Podcast widmen wir uns mit der neuen Platform zwischengrenzen.online.
Grenzsituationen, Grenzziehungen sowie Grenzüberschreitungen und ihrer Bedeutung anhand von konkreten Beispielen aus dem mittel- und südosteuropäischen Raum. Biografien stehen dabei ebenso im Mittelpunkt wie Geschichte, Sprache, Kultur und geopolitische Aspekte.
Die Platform haben wir gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München aufgebaut, im Rahmen eines gemeinsamen, von Kultur.Gemeinschaften ausgeschriebenen Förderprogramms.
Bis Jahresende werden wir wöchentlich neue Beiträge – Text, Video oder Audiofeature – veröffentlichen. Die ersten fünf Beiträge finden Sie bereits online auf: zwischengrenzen.online
Blog-Serie „Zwischen Grenzen“
Zuzana Jürgens: Wie ein Altarbild aus Tetschen nach Bayern und wieder zurückkam
Enikő Dácz: Literarische Grenzen und Entgrenzungen: Adolf Meschendörfer, Heinrich Zillich und die Literaturpolitik des Dritten Reichs
Videoreihe „Spot on“
Anna Paap: Margarete Schell
Wolfgang Schwarz: Erich Kühnhackl
Podcast „Münchner Grenzerfahrungen“
Tobias Weger: Die Geschichte überwindet Grenzen. Im Gespräch mit Konrad Gündisch
Unserer „crossmedialen“ Features gehen auf unsere wissenschaftliche Forschung zurück – und sollen gleichzeitig auf dem digitalen Weg ein breites Publikum erreichen. Darum haben wir uns auch auf der „handwerklichen“ Ebene intensiv weitergebildet und uns im Rahmen des Projektes theoretisch und praktisch mit dem Thema der digitalen Wissensvermittlung auseinandergesetzt:
Wie wird eine Online-Strategie entwickelt? Wie verfasse ich Texte, die auf Bildschirmen gerne gelesen werden? Diese Fragen haben wir gemeinsam mit der Kulturvermittlerin Dr. Tanja Praske beantwortet.
Wie entwickle ich Video- und Audioformate? Und wie kann ich sie im eigenen Haus effizient, professionell und für das Zielpublikum ansprechend produzieren? Dazu haben uns die Filmemacher Holger Gutt und Michaela Smykalla von Filmkultur geschult.
Nicht zuletzt haben wir mit dem renommierten Literatursprecher und Sprechtrainer Helmut Becker an unserer Sprechtechnik gearbeitet – neben dem Gehirn ist unsere Stimme das vielleicht wichtigste Instrument für Wissenschaftler:innen und Kulturmittler:innen, online, aber auch offline.
Die visuelle und technische Entwicklung der Online-Plattform stellt eine weitere wichtige Horizonterweiterung für uns dar. Umso dankbarer sind wir über die produktive Zusammenarbeit mit der Designerin und Expertin für strategische Markenentwicklung Susana Frau und den Entwicklern von Kollektiv17.
„Zwischen Grenzen“ ist also noch viel mehr als eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Grenzen“ – es ist ein Projekt zur „digitalen Selbstermächtigung“ unserer Einrichtungen und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Plattform zwischengrenzen.online wird zu unserer Online-Medienplattform werden, auch über das Projekt „Zwischen Grenzen“ hinaus. Für eine nachhaltige Nutzung ist also gesorgt.
Publikationen
Neues Stifter Jahrbuch
Neue Folge 37|2023
Dass der berühmte Schauspieler Alexander Moissi seine Karriere in Prag begonnen hat, ist kaum bekannt. Die Theaterhistorikerin Jitka Ludvová rekonstruiert seine Anfänge am Prager Neuen deutschen Theater und entdeckt in seiner ersten Ehefrau Marie Urfus-Moissi eine weitere interessante Protagonistin der Prager Bühne. Das Verhältnis des Berliner Kulturkritikers und Übersetzers Walter Benjamin zu Prag untersucht der Literaturhistoriker Michal Topor. Dazu hat er Rezeptionszeugnisse in deutsch- und tschechischsprachigen Prager Zeitungen zur Übersetzungstheorie Benjamins zusammengetragen und verfolgt dessen Begegnungen mit der Stadt und ihrer Literatur.
Der Salzburger Slawist und Musikwissenschaftler Ulrich Theißen Pibernik verfolgt die Spuren einer sogenannten Salonorgel, die 1931 im slowakischen Jagdschloss Duchonka für die begabte Tochter des Hauses, die junge Organistin Hedalise Haupt-Buchenrode, in prächtiger Ausstattung errichtet wurde – kurz bevor das deutschsprachige Leben am Ort zu Ende ging. Der Autor und Journalist Johannes Jetschgo setzt sich mit der Identität der Deutschböhmen zwischen deutscher, österreichischer und schließlich auch tschechischer Kultur auseinander.
Neben diesen wissenschaftlichen Beiträgen enthält der Band wie üblich den Jahresbericht 2023, Rezensionen sowie eine Zeitschriftenschau. Außerdem erinnert Franziska Mayer an den Wiener Buchwissenschaftler Murray G. Hall und seine Verdienste um die böhmische Buch- und Verlagsgeschichte.
Inhalt
Zuzana Jürgens und Franziska Mayer: Otfried Preußler und viel mehr
Nachruf
Franziska Mayer: Unerbittlich sanfter Aufklärer. Zum Tod des Buchwissenschaftlers Murray G. Hall (1947–2023)
Weitere wissenschaftliche Beiträge und Essays
Jitka Ludvová: Alexander Moissi und Prag. Ergänzungen zu seiner Biografie
Ulrich Theißen Pibernik: Silbermanns Geist in der Slowakei? Schicksal einer Salonorgel im Spannungsfeld ostmitteleuropäischer Zeit-, Kultur- und Familiengeschichte zwischen Monarchie und NS-Diktatur
Michal Topor: Walter Benjamin – eine tschechische Verortung
Johannes Jetschgo: Österreich, die Deutschböhmen und die Deutschen
Rezensionen
Thomas Krzenck – Renata Modráková: Knižní kultura kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě [Die Buchkultur des Benediktinerinnenklosters bei St. Georg auf der Prager Burg]
Thomas Krzenck – Martin Holý, Mlada Holá u. a.: Profesoři pražské utrakvistické univerzity v pozdním středověku a raném novověku (1457/1458–1622) [Die Professoren der Prager utraquistischen Universität in Spätmittelalter und früher Neuzeit (1457/1458–1622)]
Franz Adam – Adalbert Stifter: Briefe von Adalbert Stifter. Briefe bis 1848. Hrsg. v. Paul Keckeis, Werner Michler u. Karl Wagner; Adalbert Stifter: Briefe von Adalbert Stifter. Briefe bis 1854–1858. Hrsg. v. Ulrich Dittmann.
Zeitschriftenschau
Aussiger Beiträge. Germanische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre
Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe
Brücken. Zeitschrift für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft
Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien
Jahrbuch. Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich
Studia Germanistica. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis
Jahresbericht 2023
Autoren und Mitarbeiter
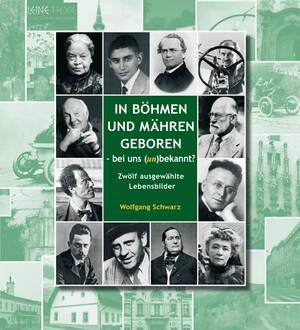
Neuauflage „In Böhmen und Mähren geboren – bei uns (un)bekannt?“
Zwölf ausgewählte Lebensbilder
Die dritte (aktualisierte und leicht erweiterte) Auflage des Buches stellt die Wurzeln bekannter Persönlichkeiten aus dem deutschen Kultur- und Sprachkreis der böhmischen Länder vor. Beiträge zu Bertha von Suttner, Ferdinand Porsche, Oskar Schindler, Adalbert Stifter, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Otfried Preußler, Gregor Mendel, Marie von Ebner-Eschenbach, Gustav Mahler, Karl Kraus, Sigmund Freud.
Mit themenbezogenen Zitaten werden auch weitere Bekanntheiten wie z. B. Ruth Maria Kubitschek, Friedrich von Thun, Alfred Biolek oder Christoph Kardinal Schönborn aufgeführt, deren Wurzeln in den böhmischen Ländern liegen.
München: 2023. 109 Seiten. ISBN: 978-3-940098-23-8. 8,00 € zzgl. Versandkosten
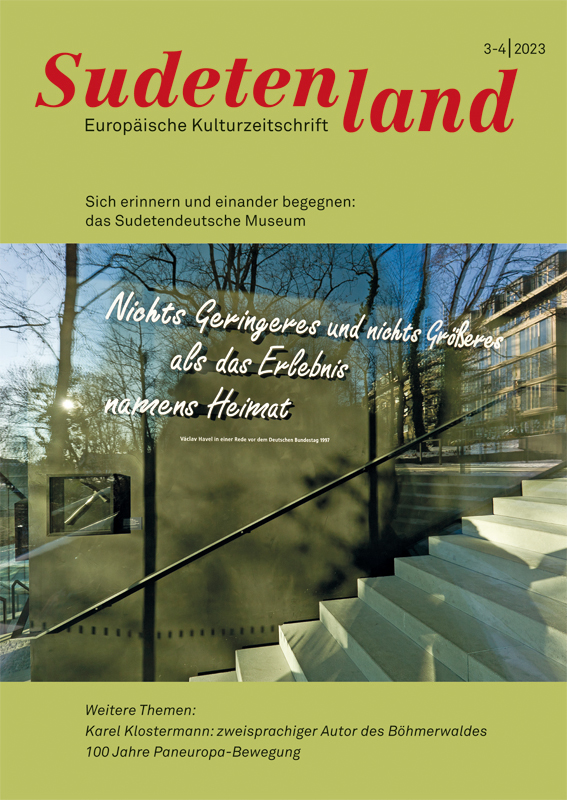
Neue Ausgabe Sudetenland
3-4|2023
Der neue Mitherausgeber stellt sich vor: Im aktuellen Heft finden Sie Berichte von Eva Haupt über die Dauerausstellung sowie über spannende Einzelausstellungen im Sudetendeutschen Museum, Raimund Paleczek beleuchtet die Hintergründe eines interessanten Objekts aus den Beständen. Das Porträt ist dem Böhmerwalddichter Kar(e)l Klostermann (1848–1923) gewidmet, der sowohl auf Deutsch als auch auf Tschechisch geschrieben und das literarische Bild dieser Landschaft maßgeblich geprägt hat. Martin Posselt und Marian Švejda erinnern an die noch heute aktuellen Ideen des Begründers der Paneuropa-Bewegung Richard Coudenhove-Kalergi. Miloš Doležal entdeckt in Gertrude Urzidil eine eigenständige Lyrikerin: Einige ihrer Gedichte finden Sie im Heft. Zdeněk Mareček denkt über die Rolle des Übersetzers in Zeiten künstlicher Intelligenz nach, und Monika Halbinger hat mit gemischten Gefühlen Milan Kunderas berühmten Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ wiedergelesen. Hansjürgen Gartner lässt zwei zeitgenössische Künstler, Roland Helmer und Christian Thanhäuser, in Dialog treten, Niels Beintker gratuliert dem Lyriker Rainer Kunze zum Geburtstag, und Peter Becher erinnert an Franz Peter Künzel, den im Mai verstorbenen langjährigen Herausgeber der Zeitschrift. Außerdem finden Sie im Heft Stefanie Boses preisgekrönte Übersetzung eines Romanausschnitts von Anna Beata Háblová, Gedichte von Ursula Haas und ein Feuilleton von Wolfgang Sréter.
Editorial
Raimund Paleczek: Klostermann, Museum und Paneuropa
Feuilleton
Wolfgang Sréter: Honig auf beiden Seiten der Grenze
Porträt: Karel Klostermann
Václav Maidl: Homo bohemicus
Ossi Heindl: Was uns vom Klostermann geblieben ist
Thema: Sudetendeutsches Museum
Eva Haupt: 1000 Jahre Geschichte
Eva Haupt: Die Künstlersignatur des Adam Eck
Eva Haupt: „Ein bisschen Magier bin ich schon …“. Ausstellung zum 100. Geburtstag von Otfried Preußler
Thema: 100 Jahre Paneuropa-Bewegung
Martin Posselt: Heimat für bedrohte Kosmopoliten
Richard Coudenhove-Kalergi: Czechen und Deutsche
„Die europäische Identität auffrischen“. Gespräch mit Marian Švejda über die tschechische Perspektive
Im Gespräch
Volksgruppen in ihren Eigenheiten betrachten. Anna Knechtel im Gespräch mit Eva Habel
Aus dem Museum
Raimund Paleczek: Entlassung aus dem österreichischen Militärdienst vor 200 Jahren
Literatur im Spiegel
Miloš Doležal: Hallo, hier niemand, nur ich. Kleines Porträt Gertrude Urzidils
Gertrude Urzidil: Keiner wird seinen eigenen Tod erfahren
Forum der Übersetzer
Zdeněk Mareček: Vom Übersetzer zum Post-Editor?
Lyrik
Ursula Haas: Klimawandelgedichte (Die Hölle am japanischen Vulkan Unzen; Maspalomas; Tulipan morgue); Zeiten (O du Morgenstund!; Mein Garten; Winter, bist du totgesagt?)
Prosa
Anna Beata Háblová: Diese Tage sind wie …
Kontexte
Hansjürgen Gartner: Werkdialoge der bildenden Kunst: Roland Helmer und Christian Thanhäuser
Wiedergelesen
Monika Halbinger: Zwischen Faszination und Ernüchterung. Milan Kunderas „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“
Würdigungen
Niels Beintker: Poesie mit großen Kinderaugen. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze
Peter Becher: Nachruf auf Franz Peter Künzel
Zuzana Jürgens: In memoriam Joachim Bruss
Rückblick
Peter Becher: Kulturgeschichtliche Ereignisse
Rezensionen
Jahresverzeichnis: 65. Jahrgang 2023
Autoren, Mitarbeiter, Bildnachweis
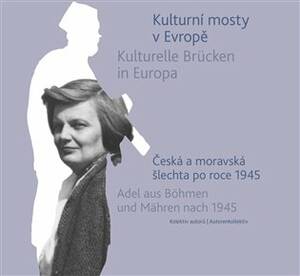
Kulturelle Brücken in Europa. Adel aus Böhmen und Mähren nach 1945
Zweisprachiger Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung, die vom Münchner Adalbert Stifter Verein initiiert wurde, ist soeben erschienen und beim Adalbert Stifter Verein sowie beim Verlag Argo bestellbar.